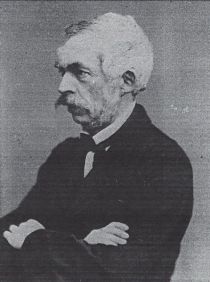Plattdeutsche Literatur – Buchbesprechung, 12. Mai 1859
Aus: Blätter für literarische Unterhaltung. Nr. 20.
Autor: Dörr, Friedrich (1831-1907) Pädagoge und Herausgeber, Erscheinungsjahr: 1859
Themenbereiche
Enthaltene Themen: Mecklenburg-Vorpommern, Sage, Volkssage, Plattdeutsch, Reuter, Groth, Brinkmann, Dorfgeschichten, Raabe, Volkssprache, Heimat, Plattdeutsche Sprache, Norddeutschland,
1. Der 1. April 1856 oder Onkel Jakob und Onkel Jochen, Lustspiel in drei Akten. Blücher in Teterow, dramatischer Schwank in einem Akt, von Fritz Reuter, Greifswald, Koch, 1857, Gr. 12. 15 Ngr.
2. Kein Hüsung. Von Fritz Reuter. Greifswald, Koch, 1858. 12. 25 Ngr.
3. En poa Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goahrn von A. W. Herausgegeben von Fritz Reuter. Greifswald, Koch. 1858. 16. 15 Ngr.
4. Aus dem Volk für das Volk. Plattdeutsche Stadt- und Dorfgeschichten. Herausgegeben von John Brinckmann, Erstes Heft: „Dat Brüden geiht üm," Zweites Heft: „Kaspar Ohm un ick." Güstrow, Opitz u. Comp. 1854 — 55. Gr. 16. 9 ¾ Ngr.
5. Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Sammlung von Dichtungen, Sagen, Märchen, Schwänken, Volks- und Kinderreimen, Sprichwörtern, Rätseln usw. Herausgegeben von H. F. W. Raabe. Wismar, Hinstorff. 1854. Gr. 16. 10 Ngr.
***********************
2. Kein Hüsung. Von Fritz Reuter. Greifswald, Koch, 1858. 12. 25 Ngr.
3. En poa Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goahrn von A. W. Herausgegeben von Fritz Reuter. Greifswald, Koch. 1858. 16. 15 Ngr.
4. Aus dem Volk für das Volk. Plattdeutsche Stadt- und Dorfgeschichten. Herausgegeben von John Brinckmann, Erstes Heft: „Dat Brüden geiht üm," Zweites Heft: „Kaspar Ohm un ick." Güstrow, Opitz u. Comp. 1854 — 55. Gr. 16. 9 ¾ Ngr.
5. Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Sammlung von Dichtungen, Sagen, Märchen, Schwänken, Volks- und Kinderreimen, Sprichwörtern, Rätseln usw. Herausgegeben von H. F. W. Raabe. Wismar, Hinstorff. 1854. Gr. 16. 10 Ngr.
***********************
Seit zu Anfang vorigen Jahres unser erster Artikel über plattdeutsche Literatur in d. Bl. stand, sind wieder verschiedene neue Erscheinungen auf diesem Gebiete der Literatur hervorgetreten, welche wir heute hier mit den noch von früherer Zeit vorliegenden zusammen besprechen wollen. Mehr und mehr gewinnt es wirklich den Anschein, als hätten die recht, welche vor der neuplattdeutschen Literatur als einer Feindin der hochdeutschen, die nichts Geringeres zur Absicht habe, als sich ihr altes Gebiet zum Alleinbesitz wieder zu erobern und sich selbst zur norddeutschen Schriftsprache zu erheben, erschraken und warnten. Man bleibt nämlich nicht einmal dabei stehen, die poetischen Gedanken in dieses Gewand der plattdeutschen Sprache zu kleiden, sondern alle Wochen fast lesen wir die Ankündigungen von Werken über die plattdeutsche Sprache; dahin gehören die Wörterbücher (außer dem gediegenen großen allgemeinen von Kosegarten, die verdienstvollen Arbeiten von Stürenberg: „Ostfriesisches Wörterbuch", und von Schambach: „Wörterbuch der niederdeutschen Mundart der Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen"), dann die „Grammatik der plattdeutschen Sprache" von Julius Wiggers und die von A. Marahrens und außer vielen andern besonders die polemische Schrift von Klaus Groth, „Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch" (Kiel 1858).
*) Vgl. den ersten Artikel in Nr. 6 d. Bl., 1858,. D. Red. 1859.
Die ausführliche Besprechung dieser Werke würde einen für d. Bl. zu weit umfassenden Raum einnehmen, auch gehören sie nicht eigentlich vor unser Forum, da wir vielmehr uns hier die Aufgabe gestellt, das in plattdeutscher Mundart Geschriebene zu besprechen; doch dürften wir in dem heutigen Artikel einigemal genötigt sein, auf das letztgenannte (übrigens in Nr. 2 d. Bl. bereits besprochene) Buch Bezug zu nehmen, und gestehen daher hier im voraus, dass wir, obgleich selbst ein Plattdeutscher und ein warmer Verehrer der lieben schönen Muttersprache, doch höchlichst erstaunt waren über die Keckheit einerseits und die Einseitigkeit andererseits, welche das Groth'sche Buch charakterisieren. Schritt vor Schritt raubt Groth der hochdeutschen Sprache jeden Anspruch auf Vorzüge irgendwelcher Art, um sie der plattdeutschen Schwester in um so höheren Maße zu vindizieren. Das heißt mit Gewalt Zwietracht hervorrufen; oder glaubt Groth wirklich die Gegner zum Schweigen zu bringen, wenn er mit einem Selbstgefühl und einer Unumwundenheit, die uns nicht geringes Bedenken macht, wo er von dem Wohllaute der plattdeutschen Sprache redet, sich selbst hoch emporhebt und Schillers bisher am meisten bewundertsten Verse aus dem „Taucher" verurteilt? Er sagt nämlich: Ein Lied von so absolutem Wohlklange wie z. B. „Hartleed" im „Quickborn", das in den tiefen Brusttönen den Schmerz malt, ist im Hochdeutschen durchaus unmöglich. Ich behaupte nicht, dass Goethe'sche, Heine'sche Verse nicht wohlklingend sind, Meister bezwingen auch das widerstrebende Element, ein Canova würde den Granit zu einer Frauenbüste weich machen. Aber der Plattdeutsche hat den Klang im Ohr, er wird, auch wenn er hochdeutsch dichtet, den Sinn mit Erfolg hinüberbringen, und die Schriftsprache wird immer von ihrer Schwester lernen und gewinnen, Schillers, des Schwaben, „Und er wallet und siedet" u. s. w. ist geradezu unschön (!), obgleich auch Goethe es bewunderte, Bürger würde es nicht bewundert haben.
Doch ersparen wir uns weitere Bemerkungen und Aussetzungen für weiter unten und gehen zu den uns vorliegenden Schriften in plattdeutscher Sprache über.
1. Der 1. April 1856 oder Onkel Jakob und Onkel Jochen, Lustspiel in drei Akten. Blücher in Teterow, dramatischer Schwank in einem Akt, von Fritz Reuter, Greifswald, Koch, 1857, Gr. 12. 15 Ngr.
2. Kein Hüsung. Von Fritz Reuter. Greifswald, Koch, 1858. 12. 25 Ngr.
3. En poa Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goahrn von A. W. Herausgegeben von Fritz Reuter. Greifswald, Koch. 1858. 16. 15 Ngr.
4. Aus dem Volk für das Volk. Plattdeutsche Stadt- und Dorfgeschichten. Herausgegeben von John Brinckmann, Erstes Heft: „Dat Brüden geiht üm," Zweites Heft: „Kaspar Ohm un ick." Güstrow, Opitz u. Comp. 1854 — 55. Gr. 16. 9 ¾ Ngr.
5. Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Sammlung von Dichtungen, Sagen, Märchen, Schwänken, Volks- und Kinderreimen, Sprichwörtern, Rätseln usw. Herausgegeben von H. F. W. Raabe. Wismar, Hinstorff. 1854. Gr. 16. 10 Ngr.
Sämtliche fünf Bücher sind in mecklenburgisch-vorpommerscher Mundart geschrieben. Voran stellen wir füglich den unermüdlichen liebenswürdigen Fritz Reuter, von dem Nr. 1 und 2 verfasst, Nr. 3 besorgt und herausgegeben worden. Schon in unserm ersten Artikel hatten wir Gelegenheit, zwei plattdeutsche Schriften dieses Dichters lobend zu besprechen: dort lernten wir ihn als trefflichen Humoristen kennen (seine „Läuschen un Rimels" sind das Lieblingsbuch der Plattdeutschen geworden), heute in Nr. 2 zeigt er, dass auch die weichen elegischen und ernsten Klänge ihm nicht fremd sind, während in Nr. 1 sein Humor in ergötzlicher Weise sich abermals offenbart. „Onkel Jakob und Onkel Jochen" gehört nur zum Teil der plattdeutschen Literatur an. Die Sprache dieses heiteren Spiels, das freilich in der Komposition vielfach aus Reminiszenzen erbaut ist, ist ein Gemengsel von Hochdeutsch, Plattdeusch und berlinischem Jargon. Onkel Jakob, ein pommerscher Bauer, hat sich bereits vor langer Zeit in der Nähe von Berlin angesiedelt und ist ein Hochdeutscher geworden, sein Bruder Jochen, der auch bereits geraume Zeit bei ihm lebt, ist noch zum Teil Plattdeutscher, er spricht in der „Messingsprache", das ist, dem seltsamen Hochdeutsch, welches der spricht, der eigentlich platt redet und hochdeutsch reden will, und das, wie wir bereits im ersten Artikel erwähnten, von Reuter wahrhaft meisterlich behandelt wird, Mariane, Jakobs Haushälterin, spricht berlinerisch, und Samuel, Jochens alter Bedienter, kann sich trotz aller Bemühungen von seiner plattdeutschen Muttersprache nicht freimachen und gerät, sobald er etwas lebendig wird, immer wieder in sie hinein. Scene vor Scene können wir dem lustigen Stück nicht folgen und es besprechen, aber verweisen zur Probe auf den Anfang. Hier kommen sofort Samuel und Mariane zusammen; diese verspottet den alten Pommer wegen seiner ,,jreulichen Muttersprache" und meint, „det die jefühlvolle, jebildete Liebe sich nich in det Plattdeutsche übersetzen lässt und dat det mit ihr in seine Muttersprache jrausam stuckert". Samuel versichert ihr das Gegenteil und will ihr zum Beweise „Spaß’s wegen" einmal eine solche Pommersch-plattdeutsche Liebeserklärung machen.
Samuel. Ick schlag also meinen Arm um Sie und wenn ick dat dahn hew, dann kick ick Ihnen grab in die Oogen, mit Lieblichkeit nämlich, und denn segg ick . . .
Mariane. Fällt Er denn nich uf die Knie?
Samuel. Knie? Nee! Wat haben die Bein damit tau dauhn? Ick segg blos: Mien leiv Dürting, ore Fieking, ore Stiening, ore Murrjahning, wenn du willst as ick will, denn sünd dien Hart un mien Hart ein Hart.
Mariane. O Jott, wie eenfach, aber och wie rührend! Un denn is et schon alle?
Samuel. For mienen Part is dat nu all. Nu kommen Sie as geliebtes Frauenzimmer.
Mariane. Na, wat muss ick denn nu as jeliebte Pommeranze duhn?
Samuel. Sie kucken mir wieder liebreich an und sagen: Ja, Jöching, ore Johanning, ore Zämeling, ick will, wat du willst, und dien Hart und mien Hart sünd beid ein Hart.
Mariane. Na, meinetwegen! Ja, Zämeling, ick will, wat du willst, und dein Herz und mein Herz sind beide ein Herz.
Samuel. So is't richtig! Nun noch einen ausdrücklichen Kuss!
Mariane. Muss det och?
Samuel. Müssen? Wat wollt nich müssen? (Mariane küsst ihn.)
Samuel. So, so! Seihn Sei, as ick noch tau Langenhanshagen wäre . . .
Indessen ist Onkel Jochen eingetreten, hat den Schluss der Scene mit angehört und lässt sich, soviel Samuel auch versichert, „dat war jo man blos Spaß", nicht ausreden, dass es sich hier um ein wirkliches Liebesverhältnis handle, er macht dem alten Diener ernste Vorwürfe über seinen jugendlichen Leichtsinn, fordert aber, nun es einmal so weit gekommen, dass es auch zu Ende geführt werde, und kurz — aus dem Spaß wird Ernst, Samuel muss, mag er wollen oder nicht, die Mariane heiraten.
Ebenso ergötzlich sind auch die übrigen Szenen, und wir können das ganze Buch nicht nur zum Lesen, sondern sogar auch Theaterdirektoren zum Aufführen empfehlen, da die Sprache, selbst wo sie plattdeutsch ist, überall verständlich geblieben.
Was Fritz Reuter aber besonders charakterisiert, das ist die Harmlosigkeit seines Scherzes, der nirgends über die Grenze des gemütlichen Spaßes hinausgeht. Reuter ist überall ein liebenswürdig-anspruchsloser, herzlich-ansprechender Schriftsteller, und um so mehr muss es uns befremden, wenn Groth in seinen Briefen in so wenig, harmloser, in so erbitterter Weise über einen Mann herfällt, dem es keinen Augenblick eingefallen ist, dem Dichter des „Quickborn" den Rang streitig zu machen. Überhaupt muss es uns wunder nehmen, wie wenig Gnade die übrigen Schriftsteller in plattdeutscher Mundart vor Groths Richterstuhl finden. Man sollte fast glauben, er fürchte jede Konkurrenz, denn Anerkennung finden eigentlich nur zwei, die allerdings seinem Ruhme keinen Abbruch tun werden: einigermaßen der verstorbene Fooke Hoissen Müller [1798-1856], dessen ganz vorzügliche Gedichte wir im ersten Artikel besprochen haben, und außerdem besonders die Gedichte der geisteskranken A. W., welche noch dazu Klaus Groth gewidmet sind. Wie hoch wir Groths Talent schätzen und ihn als Dichter achten, haben wir deutlich genug früher ausgesprochen, aber „die Kunst ist frei", und wir können kein Gottsched'sches Dictotorium gebrauchen, das uns die Flügel bindet. Wie weit der Dichter des „Ouickborn" in dieser Beziehung geht, das beweist auch seine Forderung in Betreff der plattdeutschen Orthographie, aus die wir zum Schluss der Besprechung dieser fünf Nummern kurz eingehen wollen.
Das andere Buch von Reuter, „Kein Hüsung" (Hüsung heißt zunächst: Wohnung, dann auch: Niederlassungsrecht), ist recht eigentlich geeignet, sich unter dem Volke Mecklenburgs freundliche Aufnahme zu erwerben, da der Dichter mit dem ihm eigenen sichern Gefühl, volkstümliche Stoffe zu ergreifen, das hier einen Gegenstand zum Vorwurf gewählt hat, der für die Mecklenburger Verhältnisse leider so charakteristisch ist. Die abhängige Lage der Landleute, das unnatürliche Verhältnis zwischen Herr und Knecht, das eigentlich von der Leibeigenschaft nur mehr durch den Namen unterschieden ist, dieses ist das Grundthema der idyllischen Erzählung. Dass es da nicht mehr luftig hergehen kann, dass da dem sonst unerschöpflich heitern Reuter selbst der Humor vollständig ausgeht, wen wird es wundern? Zumal wenn er hört, dass der Dichter nicht der Mann ist, der nur volkstümlich schreibt, weil er auf das Volk spekuliert, sondern der von Liebe und wackeren Eifer für die Verbesserung der Lage seiner Landsleute erfüllt ist. Das beweist die Wärme der Darstellung durch das ganze Buch, seine offene Parteinahme gegenüber dem Junkertum, die allerdings den Verfasser bisweilen zu einigen Schroffheiten verleitet hat. Wer offenen Sinn und ein warmes Herz für das Volk hat, dem dürfen wir das Büchlein, das in seinem Kerne eine sozialistische Tendenz birgt, empfehlen: aber auch der Freund spannender Erzählungen und malerischer Bilder und Szenen wird dem Buche sicherlich Geschmack abgewinnen Reuters Schilderungen zeichnen sich vorteilhaft aus, sie gelingen ihm immer, sie sind plastisch, anschaulich, warm, lebendig, und was die Hauptsache ist, wahr.
Die Verfasserin des dritten Buchs: „En poa Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goahrn", das von Fritz Reuter herausgegeben, ist offenbar ein eminentes Talent, dem selbst Groth seine Anerkennung nicht versagen kann. Die Gedichte sind einfach, herzlich und naiv, ohne gerade gedankenreich zu sein. Aber das will auch die Dichterin nicht; sie gibt sich wie sie ist, wie sie denkt und empfindet wenn die schreckliche Krankheit, welche schon seit Jahren ihren Geist so sehr zerrüttet hat, „die sie fern hält von ihrem an häuslichem Segen reichen Kreise und sie außer Stand setzt, den Pflichten als Gattin und Mutter zu genügen", einmal nachlässt und qualfreie, lichte Momente ihr ein klares Denken gestatten. Die Gedichte haben durchaus nichts Krankhaftes, obwohl sie aus unglücklichem Herzen gequollen sind, aber Ergebung in den Willen des Himmels und ruhiges Dulden treten uns überall aus den eigentlichen Empfindungsliedern entgegen. Ein edles zartbesaitetes Frauenherz erkennen wir auf jeder Seite des Buchs, das aber selbst unter den schrecklichsten Leiden sich einen freien, offenen, ja mitunter gar heiteren Sinn bewahrt. Zu den schönsten Gedichten der Sammlung gehören die vielen Bilderchen aus dem Naturleben: „Vagelleed", „Sparlings bi dei Schün", „Dubenmutte" usw. Wir können das Buch wohl nicht besser empfehlen, als wenn wir hier die wenigen Worte Groths, dem das Buch gewidmet ist, hinzufügen, die wir in seinen „Briefen über Plattdeutsch und Hochdeutsch" finden:
Ich las wirklich zum ersten mal (!) ein plattdeutsches Buch mit Vergnügen; der Geist, in dem es geschrieben, wie die Form, in die er sich gekleidet, sind ansprechend, sind anmutig. Die Frau schreibt einfach, wie ihr ums Herz ist und schreibt das so treuherzig, wie man es nur im heimlichen Stübchen der Mutter, dem Liebsten, dem Kindchen oder dem Vater dort oben aussprechen kann, es ist immer wie Kosen oder Gebet, oft auch das herzliche Lachen oder Weinen, wie es das vertraute Ohr gewohnt ist. Sie künstelt sich nirgends erst einen Geist oder ein Gefühl oder eine Stimmung an, weder eine hohe noch eine rohe, um dann dafür mühsam Worte und Reime zu suchen, aber sie hat Geist und Gefühl und spricht sie aus oft tief erschütternd.
Die unter dem Titel „Aus dem Volk für das Volk" erschienenen plattdeutschen Stadt- und Dorfgeschichten von Brinckmann (Nr. 4) sind ebenfalls höchst ansprechende Erzählungen für das Volk, dem sie dadurch noch mehr zugänglich gemacht sind, dass sie einzeln in kleinen Heftchen zu sehr billigem Preise verkauft werden. Möchte ihnen das zu der weilen Verbreitung verhelfen, die sie ihrem gesunden Inhalte und der bequemen heitern Form nach beanspruchen dürfen. Besonders anziehend ist das erste Heftchen: „Dat Brüden geiht üm", das eine Umarbeitung des bekannten lustigen Märchens vom Igel und Hasen enthält. Wir stimmen ganz mit den vom Verfasser im Vorwort gemachten Aussetzungen an der bisherigen Fassung der Fabel und danken ihm für die Änderung, wodurch der Schluss des Schwanks harmlos und sittlich gerechtfertigt erscheint. Weniger verständlich, obgleich treffend und spannend ist die zweite Erzählung: „Kaspar Ohm un ick." Bei Anwendung der vielen seemännischen Ausdrücke, welche auch ein Glossar notwendig gemacht haben, und denen sich noch manche englische und französische Phrasen beigesellen, hat doch der Verfasser zu wenig auf das Volk Rücksicht genommen, dem das Verständnis der an und für sich schon nicht so leicht zu lesenden, weil ungewohnten plattdeutschen Schrift auf jede mögliche Weise erleichtert, nicht aber erschwert werden musste. Das auf der Rückseite des zweiten Heftes in Aussicht gestellte dritte Heft, enthaltend „Dat Leuschen von den Hähkt und den Voß", das wohl wiederum in dem Genre der ersten Erzählung gehalten sein möchte, ist uns nicht zugegangen, auch wissen wir nicht, ob der Verfasser seine Geschichten fortgesetzt hat. Wenn es aber geschehen, und die ferneren Geschichten in der Weise wie die erste zugänglich und einfach sind, so werden wir sie als einen beachtungswerten Zuwachs der Volksliteratur begrüßen.
Besondere Berücksichtigung und Teilnahme verdient das „Allgemeine plattdeutsche Volksbuch" von Raabe (Nr. 6), das eine in der Tat sehr reichhaltige Sammlung aller im niedersächsischen Volke umgehenden Märchen, Schwänke, Volks- und Kinderreime, Sprichwörter und Rätsel enthält. Fleiß und Sorgfalt des Herausgebers verdienen unsere volle Anerkennung, und wissen wir wohl die große Mühe zu schätzen, welche die Sammlung beanspruchte, namentlich da sie eigentlich die erste ist. Besonders vollständig ist die Sammlung von Sprichwörtern, und haben wir bei sorgfältiger Prüfung fast kein einziges der uns bekannten vermisst, obwohl Schreiber dieses Schleswiger ist und um so eher voraussetzen durfte, dass dem Verfasser als Mecklenburger manche Sprichwörter aus seiner nördlichen Heimat möchten unbekannt geblieben sein. An Sprichwörtern aber ist schwerlich ein Volk so reich als das plattdeutsche, und immer sind sie, wenn auch derb, zutreffend und schlagend und der Humor in ihnen unverwüstlich. Außer der Sammlung von Sprichwörtern und Volksliedern, denen sich auch eine Darstellung von „allerhand olle Gebrüke un Awerglowen" zugesellt, finden wir hier nicht nur Bruchstücke aus alten plattdeutschen Schriftstücken, so „Ut dei Likenpredigt" des berühmten Predigers Jobst Sackmann (gestorben 1718), aus „De vier olle beräumde Scherzgedichte" von Lauremberg, und Lieder, die wir noch oft von unseren Großeltern haben singen hören, sondern auch die besten und volkstümlichsten von Klaus Groth, das reizende Idyll „De Fahrt na de Isenbahn" von Sophie Dethleffs, das 1850 zuerst im „Volksbuch für Schleswig-Holstein und Lauenburg" erschien, in Holstein für die plattdeutsche Literatur epochemachend wirkte und als Vorläufer des „Quickborn" betrachtet werden kann, ferner Lieder von Bornemann, Reuter u. a.
Das ganze Buch ist eine dankenswerte Gabe und verdient die weiteste Verbreitung; nur eins war uns bedenkenerregend, der Titel „allgemeines" plattdeutsches Volksbuch, da die Sprache desselben ausschließlich auf den Mecklenburger Dialekt beschränkt ist, und der Herausgeber zum offenbaren Nachteil der Gedichte Groths und anderer Nicht-Mecklenburger diese in Mecklenburger Mundart übertragen hat.
Wir kommen damit aber auf einen Tadel, den wir sämtlichen fünf hier besprochenen Büchern nicht erlassen, können und der besonders die Orthographie betrifft. Ohne Zweifel haben die plattdeutschen Schriftsteller in Mecklenburg am meisten den Volkston getroffen und sind ihre Gedichte, wenn auch von weniger hochpoetischem Fluge als die der Holsteiner und des Ostfriesen Müller, weit mehr volkstümlich, verständlich und einfach, wenn die Dichter sich nur dazu verstehen wollten, einmal ein kleines Wörterverzeichnis beizufügen und zweitens nicht einer so ungeheuerlichen Orthographie zu huldigen. Die Mundart der Mecklenburger ist die weichste, die Laute in ihr sind am meisten verwischt und daher am wenigsten mit der gewöhnlichen Aussprache der hochdeutschen Schriftlichen übereinstimmend. Ein allgemeines plattdeutsches Volksbuch ist offenbar keineswegs auf Mecklenburg allein berechnet, aber auch selbst da kann das Bestreben, den Laut genau durch Schriftlichen wiederzugeben, nur zu Irrungen und Missverständnissen Anlass geben. Zudem war es aber auch gar nicht nötig und würde eine dem Stamme folgende Schreibung der Wörter durchaus denselben Zweck erfüllt haben. Um nicht zu weit abzuschweifen, sei es uns an einem schlagenden Beispiele gestattet, unsere Meinung zu verteidigen. Die reine und richtige Aussprache des Buchstaben r durch rasches zitterndes Anschnellen der Zungenspitze gegen den Gaumen und die obere Zahnreihe ist, wie überhaupt in Deutschland, besonders den Norddeutschen fast unmöglich, als Ersatz dient uns ein schnarchender Laut im Kehlkopfe. Je mehr dieser sich von dem richtigen Klange des r entfernt, um so mehr nähert er sich dem vokalischen Laute des a. Bei dem Mecklenburger ist er nun fast ganz zum a geworden, aber nichts berechtigt darum die Schriftsteller in dieser Mundart, das r durch a zu ersetzen, wenn dadurch, die Unverständlichkeit so bedeutend erhöht wird, wie es geschieht. Wer denkt bei „Pia" noch an den Plural von „Pierd" (Pferd), wer bei „goa" an „gor" (gar). Die Notwendigkeit zwang keineswegs zu dieser Abweichung, denn den Mecklenburger selbst befremdet die Schreibung, da er es sich nicht einfallen lässt, er spreche kein r, wenn er statt dessen a tönen lässt; er spricht das Schluss-r immer so, und würde also durchaus seinem Dialekte gemäß richtig Pia lesen, wenn auch „Pier" geschrieben steht. Wir geben es den Mecklenburger Schriftstellern zu bedenken, wie sehr sie durch ihre Eigentümlichkeit in der Rechtschreibung der Verbreitung ihm Schriften schaden, wollen aber hier auch zugleich allgemein warnen vor jeder zu genau nachahmenden Darstellung der Laute durch Schriftlichen, damit nicht eine heillose Verwirrung eintrete. Die plattdeutschen Mundarten sind enge verwandt, die ostfriesische und holsteinische z. B. gar nicht so sehr verschieden, aber ewig werden sie getrennt und einander fremd bleiben, wenn immer der eigentliche Laut jeder Landschaft durch Schriftzeichen soll wiedergegeben werden, was noch zudem überall nicht möglich ist. Wer kann sagen, was die Folge wäre, wollte der Schwabe, der Sachse, der Berliner, der Holsteiner das hochdeutsche Wort schreiben, wie er es ausspricht? Vor allem verwerflich aber und wenig volkstümlich ist es, wenn gar neue Zeichen in die Schrift hineingebracht werden, welche die hochdeutsche Schrift nicht kennt, die an Nachbarvölkern entlehnt werden und doch zu nichts nützen. Dahin gehört die Anwendung des dänischen a, eines eigentümlichen, aus a und e vereinigten Schriftzeichens, oder des e mit der französischen Cedille. Beides findet sich in der Groth'schen Orthographie, scheint uns aber durchaus unstatthaft, wenn man bedenkt, dass das Volk in Norddeutschland an und für sich schwer hochdeutsch, noch schwerer das ungewohnte Plattdeutsch liest, und nun sich mit ganz neuen und fremdartigen Schriftzeichen abplacken muss, die es schwer begreift und erlernt, die auszusprechen es sich vergebens abmüht, und nicht ahnt, dass es sich hier um einen Laut handelt, den er täglich über die Zunge bringt, der sein ganz eigentliches Eigentum ist. Wenn daher Groth in ziemlich diktatorischer Weise Professor Wiggers wegen der von ihm erfundenen und befolgten Rechtschreibung maßregelt und fragt: „Ich frage jeden plattdeutschen Schriftsteller aufs Gewissen (!), ob er wirklich die ganze Sache vorher durchdacht hat, ehe er von der Schreibung, wie Möllenhoff und ich sie wohlüberlegt nun doch einmal als die ersten, die die Arbeit tun mussten, festgestellt haben", und weiter! „Warum weicht also Wiggers von uns ab?" so antworten wir, wenigstens soweit uns als Herausgeber des „Plattdütschen Volkskalenders" diese Frage angeht, in aller Bescheidenheit: dass wir uns von der Richtigkeil der nur halb an den Stamm, nur halb an die Aussprache angelehnten, daher unzuverlässigen Schreibweise nicht haben überzeugen können, dass wir nicht Lust hatten, neue Schriftlichen einzuführen, welche in den deutschen Officinen fehlen, und zu deren Anschaffung sich die Verleger nicht immer verstehen, dass wir aber auch den plattdeutschen Lesern, auf welche zunächst doch die Schriften berechnet waren, nicht zumuten mochten, ihre alltäglichen Laute durch fremde unverständliche Zeichen vorgeführt zu sehen, und dass endlich die Bezeichnung in der Groitschen Orthographie möglicherweise für seine, die ditmarsche Mundart, ausreichen mag, die abweichenden Laute der übrigen Dialekte aber eine von jenen unabhängige Bezeichnung verlangen. Der Laut zwischen ä und ö z. B., den Groth durch das dänische ae bezeichnet, findet sich fast nur im ditmarschen Dialekt, wozu sollten wir denn das neue Schriftzeichen einführen? Für den Laut hingegen zwischen ö und den zwischen oi, ei und ee, die fast allen Plattdeutschen angehören-(grön, spr. fast groin; ick weet, spr. fast weit), bietet Groth uns keine Zeichen; kann da seine Orthographie genügen?
*) Vgl. den ersten Artikel in Nr. 6 d. Bl., 1858,. D. Red. 1859.
Die ausführliche Besprechung dieser Werke würde einen für d. Bl. zu weit umfassenden Raum einnehmen, auch gehören sie nicht eigentlich vor unser Forum, da wir vielmehr uns hier die Aufgabe gestellt, das in plattdeutscher Mundart Geschriebene zu besprechen; doch dürften wir in dem heutigen Artikel einigemal genötigt sein, auf das letztgenannte (übrigens in Nr. 2 d. Bl. bereits besprochene) Buch Bezug zu nehmen, und gestehen daher hier im voraus, dass wir, obgleich selbst ein Plattdeutscher und ein warmer Verehrer der lieben schönen Muttersprache, doch höchlichst erstaunt waren über die Keckheit einerseits und die Einseitigkeit andererseits, welche das Groth'sche Buch charakterisieren. Schritt vor Schritt raubt Groth der hochdeutschen Sprache jeden Anspruch auf Vorzüge irgendwelcher Art, um sie der plattdeutschen Schwester in um so höheren Maße zu vindizieren. Das heißt mit Gewalt Zwietracht hervorrufen; oder glaubt Groth wirklich die Gegner zum Schweigen zu bringen, wenn er mit einem Selbstgefühl und einer Unumwundenheit, die uns nicht geringes Bedenken macht, wo er von dem Wohllaute der plattdeutschen Sprache redet, sich selbst hoch emporhebt und Schillers bisher am meisten bewundertsten Verse aus dem „Taucher" verurteilt? Er sagt nämlich: Ein Lied von so absolutem Wohlklange wie z. B. „Hartleed" im „Quickborn", das in den tiefen Brusttönen den Schmerz malt, ist im Hochdeutschen durchaus unmöglich. Ich behaupte nicht, dass Goethe'sche, Heine'sche Verse nicht wohlklingend sind, Meister bezwingen auch das widerstrebende Element, ein Canova würde den Granit zu einer Frauenbüste weich machen. Aber der Plattdeutsche hat den Klang im Ohr, er wird, auch wenn er hochdeutsch dichtet, den Sinn mit Erfolg hinüberbringen, und die Schriftsprache wird immer von ihrer Schwester lernen und gewinnen, Schillers, des Schwaben, „Und er wallet und siedet" u. s. w. ist geradezu unschön (!), obgleich auch Goethe es bewunderte, Bürger würde es nicht bewundert haben.
Doch ersparen wir uns weitere Bemerkungen und Aussetzungen für weiter unten und gehen zu den uns vorliegenden Schriften in plattdeutscher Sprache über.
1. Der 1. April 1856 oder Onkel Jakob und Onkel Jochen, Lustspiel in drei Akten. Blücher in Teterow, dramatischer Schwank in einem Akt, von Fritz Reuter, Greifswald, Koch, 1857, Gr. 12. 15 Ngr.
2. Kein Hüsung. Von Fritz Reuter. Greifswald, Koch, 1858. 12. 25 Ngr.
3. En poa Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goahrn von A. W. Herausgegeben von Fritz Reuter. Greifswald, Koch. 1858. 16. 15 Ngr.
4. Aus dem Volk für das Volk. Plattdeutsche Stadt- und Dorfgeschichten. Herausgegeben von John Brinckmann, Erstes Heft: „Dat Brüden geiht üm," Zweites Heft: „Kaspar Ohm un ick." Güstrow, Opitz u. Comp. 1854 — 55. Gr. 16. 9 ¾ Ngr.
5. Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Sammlung von Dichtungen, Sagen, Märchen, Schwänken, Volks- und Kinderreimen, Sprichwörtern, Rätseln usw. Herausgegeben von H. F. W. Raabe. Wismar, Hinstorff. 1854. Gr. 16. 10 Ngr.
Sämtliche fünf Bücher sind in mecklenburgisch-vorpommerscher Mundart geschrieben. Voran stellen wir füglich den unermüdlichen liebenswürdigen Fritz Reuter, von dem Nr. 1 und 2 verfasst, Nr. 3 besorgt und herausgegeben worden. Schon in unserm ersten Artikel hatten wir Gelegenheit, zwei plattdeutsche Schriften dieses Dichters lobend zu besprechen: dort lernten wir ihn als trefflichen Humoristen kennen (seine „Läuschen un Rimels" sind das Lieblingsbuch der Plattdeutschen geworden), heute in Nr. 2 zeigt er, dass auch die weichen elegischen und ernsten Klänge ihm nicht fremd sind, während in Nr. 1 sein Humor in ergötzlicher Weise sich abermals offenbart. „Onkel Jakob und Onkel Jochen" gehört nur zum Teil der plattdeutschen Literatur an. Die Sprache dieses heiteren Spiels, das freilich in der Komposition vielfach aus Reminiszenzen erbaut ist, ist ein Gemengsel von Hochdeutsch, Plattdeusch und berlinischem Jargon. Onkel Jakob, ein pommerscher Bauer, hat sich bereits vor langer Zeit in der Nähe von Berlin angesiedelt und ist ein Hochdeutscher geworden, sein Bruder Jochen, der auch bereits geraume Zeit bei ihm lebt, ist noch zum Teil Plattdeutscher, er spricht in der „Messingsprache", das ist, dem seltsamen Hochdeutsch, welches der spricht, der eigentlich platt redet und hochdeutsch reden will, und das, wie wir bereits im ersten Artikel erwähnten, von Reuter wahrhaft meisterlich behandelt wird, Mariane, Jakobs Haushälterin, spricht berlinerisch, und Samuel, Jochens alter Bedienter, kann sich trotz aller Bemühungen von seiner plattdeutschen Muttersprache nicht freimachen und gerät, sobald er etwas lebendig wird, immer wieder in sie hinein. Scene vor Scene können wir dem lustigen Stück nicht folgen und es besprechen, aber verweisen zur Probe auf den Anfang. Hier kommen sofort Samuel und Mariane zusammen; diese verspottet den alten Pommer wegen seiner ,,jreulichen Muttersprache" und meint, „det die jefühlvolle, jebildete Liebe sich nich in det Plattdeutsche übersetzen lässt und dat det mit ihr in seine Muttersprache jrausam stuckert". Samuel versichert ihr das Gegenteil und will ihr zum Beweise „Spaß’s wegen" einmal eine solche Pommersch-plattdeutsche Liebeserklärung machen.
Samuel. Ick schlag also meinen Arm um Sie und wenn ick dat dahn hew, dann kick ick Ihnen grab in die Oogen, mit Lieblichkeit nämlich, und denn segg ick . . .
Mariane. Fällt Er denn nich uf die Knie?
Samuel. Knie? Nee! Wat haben die Bein damit tau dauhn? Ick segg blos: Mien leiv Dürting, ore Fieking, ore Stiening, ore Murrjahning, wenn du willst as ick will, denn sünd dien Hart un mien Hart ein Hart.
Mariane. O Jott, wie eenfach, aber och wie rührend! Un denn is et schon alle?
Samuel. For mienen Part is dat nu all. Nu kommen Sie as geliebtes Frauenzimmer.
Mariane. Na, wat muss ick denn nu as jeliebte Pommeranze duhn?
Samuel. Sie kucken mir wieder liebreich an und sagen: Ja, Jöching, ore Johanning, ore Zämeling, ick will, wat du willst, und dien Hart und mien Hart sünd beid ein Hart.
Mariane. Na, meinetwegen! Ja, Zämeling, ick will, wat du willst, und dein Herz und mein Herz sind beide ein Herz.
Samuel. So is't richtig! Nun noch einen ausdrücklichen Kuss!
Mariane. Muss det och?
Samuel. Müssen? Wat wollt nich müssen? (Mariane küsst ihn.)
Samuel. So, so! Seihn Sei, as ick noch tau Langenhanshagen wäre . . .
Indessen ist Onkel Jochen eingetreten, hat den Schluss der Scene mit angehört und lässt sich, soviel Samuel auch versichert, „dat war jo man blos Spaß", nicht ausreden, dass es sich hier um ein wirkliches Liebesverhältnis handle, er macht dem alten Diener ernste Vorwürfe über seinen jugendlichen Leichtsinn, fordert aber, nun es einmal so weit gekommen, dass es auch zu Ende geführt werde, und kurz — aus dem Spaß wird Ernst, Samuel muss, mag er wollen oder nicht, die Mariane heiraten.
Ebenso ergötzlich sind auch die übrigen Szenen, und wir können das ganze Buch nicht nur zum Lesen, sondern sogar auch Theaterdirektoren zum Aufführen empfehlen, da die Sprache, selbst wo sie plattdeutsch ist, überall verständlich geblieben.
Was Fritz Reuter aber besonders charakterisiert, das ist die Harmlosigkeit seines Scherzes, der nirgends über die Grenze des gemütlichen Spaßes hinausgeht. Reuter ist überall ein liebenswürdig-anspruchsloser, herzlich-ansprechender Schriftsteller, und um so mehr muss es uns befremden, wenn Groth in seinen Briefen in so wenig, harmloser, in so erbitterter Weise über einen Mann herfällt, dem es keinen Augenblick eingefallen ist, dem Dichter des „Quickborn" den Rang streitig zu machen. Überhaupt muss es uns wunder nehmen, wie wenig Gnade die übrigen Schriftsteller in plattdeutscher Mundart vor Groths Richterstuhl finden. Man sollte fast glauben, er fürchte jede Konkurrenz, denn Anerkennung finden eigentlich nur zwei, die allerdings seinem Ruhme keinen Abbruch tun werden: einigermaßen der verstorbene Fooke Hoissen Müller [1798-1856], dessen ganz vorzügliche Gedichte wir im ersten Artikel besprochen haben, und außerdem besonders die Gedichte der geisteskranken A. W., welche noch dazu Klaus Groth gewidmet sind. Wie hoch wir Groths Talent schätzen und ihn als Dichter achten, haben wir deutlich genug früher ausgesprochen, aber „die Kunst ist frei", und wir können kein Gottsched'sches Dictotorium gebrauchen, das uns die Flügel bindet. Wie weit der Dichter des „Ouickborn" in dieser Beziehung geht, das beweist auch seine Forderung in Betreff der plattdeutschen Orthographie, aus die wir zum Schluss der Besprechung dieser fünf Nummern kurz eingehen wollen.
Das andere Buch von Reuter, „Kein Hüsung" (Hüsung heißt zunächst: Wohnung, dann auch: Niederlassungsrecht), ist recht eigentlich geeignet, sich unter dem Volke Mecklenburgs freundliche Aufnahme zu erwerben, da der Dichter mit dem ihm eigenen sichern Gefühl, volkstümliche Stoffe zu ergreifen, das hier einen Gegenstand zum Vorwurf gewählt hat, der für die Mecklenburger Verhältnisse leider so charakteristisch ist. Die abhängige Lage der Landleute, das unnatürliche Verhältnis zwischen Herr und Knecht, das eigentlich von der Leibeigenschaft nur mehr durch den Namen unterschieden ist, dieses ist das Grundthema der idyllischen Erzählung. Dass es da nicht mehr luftig hergehen kann, dass da dem sonst unerschöpflich heitern Reuter selbst der Humor vollständig ausgeht, wen wird es wundern? Zumal wenn er hört, dass der Dichter nicht der Mann ist, der nur volkstümlich schreibt, weil er auf das Volk spekuliert, sondern der von Liebe und wackeren Eifer für die Verbesserung der Lage seiner Landsleute erfüllt ist. Das beweist die Wärme der Darstellung durch das ganze Buch, seine offene Parteinahme gegenüber dem Junkertum, die allerdings den Verfasser bisweilen zu einigen Schroffheiten verleitet hat. Wer offenen Sinn und ein warmes Herz für das Volk hat, dem dürfen wir das Büchlein, das in seinem Kerne eine sozialistische Tendenz birgt, empfehlen: aber auch der Freund spannender Erzählungen und malerischer Bilder und Szenen wird dem Buche sicherlich Geschmack abgewinnen Reuters Schilderungen zeichnen sich vorteilhaft aus, sie gelingen ihm immer, sie sind plastisch, anschaulich, warm, lebendig, und was die Hauptsache ist, wahr.
Die Verfasserin des dritten Buchs: „En poa Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goahrn", das von Fritz Reuter herausgegeben, ist offenbar ein eminentes Talent, dem selbst Groth seine Anerkennung nicht versagen kann. Die Gedichte sind einfach, herzlich und naiv, ohne gerade gedankenreich zu sein. Aber das will auch die Dichterin nicht; sie gibt sich wie sie ist, wie sie denkt und empfindet wenn die schreckliche Krankheit, welche schon seit Jahren ihren Geist so sehr zerrüttet hat, „die sie fern hält von ihrem an häuslichem Segen reichen Kreise und sie außer Stand setzt, den Pflichten als Gattin und Mutter zu genügen", einmal nachlässt und qualfreie, lichte Momente ihr ein klares Denken gestatten. Die Gedichte haben durchaus nichts Krankhaftes, obwohl sie aus unglücklichem Herzen gequollen sind, aber Ergebung in den Willen des Himmels und ruhiges Dulden treten uns überall aus den eigentlichen Empfindungsliedern entgegen. Ein edles zartbesaitetes Frauenherz erkennen wir auf jeder Seite des Buchs, das aber selbst unter den schrecklichsten Leiden sich einen freien, offenen, ja mitunter gar heiteren Sinn bewahrt. Zu den schönsten Gedichten der Sammlung gehören die vielen Bilderchen aus dem Naturleben: „Vagelleed", „Sparlings bi dei Schün", „Dubenmutte" usw. Wir können das Buch wohl nicht besser empfehlen, als wenn wir hier die wenigen Worte Groths, dem das Buch gewidmet ist, hinzufügen, die wir in seinen „Briefen über Plattdeutsch und Hochdeutsch" finden:
Ich las wirklich zum ersten mal (!) ein plattdeutsches Buch mit Vergnügen; der Geist, in dem es geschrieben, wie die Form, in die er sich gekleidet, sind ansprechend, sind anmutig. Die Frau schreibt einfach, wie ihr ums Herz ist und schreibt das so treuherzig, wie man es nur im heimlichen Stübchen der Mutter, dem Liebsten, dem Kindchen oder dem Vater dort oben aussprechen kann, es ist immer wie Kosen oder Gebet, oft auch das herzliche Lachen oder Weinen, wie es das vertraute Ohr gewohnt ist. Sie künstelt sich nirgends erst einen Geist oder ein Gefühl oder eine Stimmung an, weder eine hohe noch eine rohe, um dann dafür mühsam Worte und Reime zu suchen, aber sie hat Geist und Gefühl und spricht sie aus oft tief erschütternd.
Die unter dem Titel „Aus dem Volk für das Volk" erschienenen plattdeutschen Stadt- und Dorfgeschichten von Brinckmann (Nr. 4) sind ebenfalls höchst ansprechende Erzählungen für das Volk, dem sie dadurch noch mehr zugänglich gemacht sind, dass sie einzeln in kleinen Heftchen zu sehr billigem Preise verkauft werden. Möchte ihnen das zu der weilen Verbreitung verhelfen, die sie ihrem gesunden Inhalte und der bequemen heitern Form nach beanspruchen dürfen. Besonders anziehend ist das erste Heftchen: „Dat Brüden geiht üm", das eine Umarbeitung des bekannten lustigen Märchens vom Igel und Hasen enthält. Wir stimmen ganz mit den vom Verfasser im Vorwort gemachten Aussetzungen an der bisherigen Fassung der Fabel und danken ihm für die Änderung, wodurch der Schluss des Schwanks harmlos und sittlich gerechtfertigt erscheint. Weniger verständlich, obgleich treffend und spannend ist die zweite Erzählung: „Kaspar Ohm un ick." Bei Anwendung der vielen seemännischen Ausdrücke, welche auch ein Glossar notwendig gemacht haben, und denen sich noch manche englische und französische Phrasen beigesellen, hat doch der Verfasser zu wenig auf das Volk Rücksicht genommen, dem das Verständnis der an und für sich schon nicht so leicht zu lesenden, weil ungewohnten plattdeutschen Schrift auf jede mögliche Weise erleichtert, nicht aber erschwert werden musste. Das auf der Rückseite des zweiten Heftes in Aussicht gestellte dritte Heft, enthaltend „Dat Leuschen von den Hähkt und den Voß", das wohl wiederum in dem Genre der ersten Erzählung gehalten sein möchte, ist uns nicht zugegangen, auch wissen wir nicht, ob der Verfasser seine Geschichten fortgesetzt hat. Wenn es aber geschehen, und die ferneren Geschichten in der Weise wie die erste zugänglich und einfach sind, so werden wir sie als einen beachtungswerten Zuwachs der Volksliteratur begrüßen.
Besondere Berücksichtigung und Teilnahme verdient das „Allgemeine plattdeutsche Volksbuch" von Raabe (Nr. 6), das eine in der Tat sehr reichhaltige Sammlung aller im niedersächsischen Volke umgehenden Märchen, Schwänke, Volks- und Kinderreime, Sprichwörter und Rätsel enthält. Fleiß und Sorgfalt des Herausgebers verdienen unsere volle Anerkennung, und wissen wir wohl die große Mühe zu schätzen, welche die Sammlung beanspruchte, namentlich da sie eigentlich die erste ist. Besonders vollständig ist die Sammlung von Sprichwörtern, und haben wir bei sorgfältiger Prüfung fast kein einziges der uns bekannten vermisst, obwohl Schreiber dieses Schleswiger ist und um so eher voraussetzen durfte, dass dem Verfasser als Mecklenburger manche Sprichwörter aus seiner nördlichen Heimat möchten unbekannt geblieben sein. An Sprichwörtern aber ist schwerlich ein Volk so reich als das plattdeutsche, und immer sind sie, wenn auch derb, zutreffend und schlagend und der Humor in ihnen unverwüstlich. Außer der Sammlung von Sprichwörtern und Volksliedern, denen sich auch eine Darstellung von „allerhand olle Gebrüke un Awerglowen" zugesellt, finden wir hier nicht nur Bruchstücke aus alten plattdeutschen Schriftstücken, so „Ut dei Likenpredigt" des berühmten Predigers Jobst Sackmann (gestorben 1718), aus „De vier olle beräumde Scherzgedichte" von Lauremberg, und Lieder, die wir noch oft von unseren Großeltern haben singen hören, sondern auch die besten und volkstümlichsten von Klaus Groth, das reizende Idyll „De Fahrt na de Isenbahn" von Sophie Dethleffs, das 1850 zuerst im „Volksbuch für Schleswig-Holstein und Lauenburg" erschien, in Holstein für die plattdeutsche Literatur epochemachend wirkte und als Vorläufer des „Quickborn" betrachtet werden kann, ferner Lieder von Bornemann, Reuter u. a.
Das ganze Buch ist eine dankenswerte Gabe und verdient die weiteste Verbreitung; nur eins war uns bedenkenerregend, der Titel „allgemeines" plattdeutsches Volksbuch, da die Sprache desselben ausschließlich auf den Mecklenburger Dialekt beschränkt ist, und der Herausgeber zum offenbaren Nachteil der Gedichte Groths und anderer Nicht-Mecklenburger diese in Mecklenburger Mundart übertragen hat.
Wir kommen damit aber auf einen Tadel, den wir sämtlichen fünf hier besprochenen Büchern nicht erlassen, können und der besonders die Orthographie betrifft. Ohne Zweifel haben die plattdeutschen Schriftsteller in Mecklenburg am meisten den Volkston getroffen und sind ihre Gedichte, wenn auch von weniger hochpoetischem Fluge als die der Holsteiner und des Ostfriesen Müller, weit mehr volkstümlich, verständlich und einfach, wenn die Dichter sich nur dazu verstehen wollten, einmal ein kleines Wörterverzeichnis beizufügen und zweitens nicht einer so ungeheuerlichen Orthographie zu huldigen. Die Mundart der Mecklenburger ist die weichste, die Laute in ihr sind am meisten verwischt und daher am wenigsten mit der gewöhnlichen Aussprache der hochdeutschen Schriftlichen übereinstimmend. Ein allgemeines plattdeutsches Volksbuch ist offenbar keineswegs auf Mecklenburg allein berechnet, aber auch selbst da kann das Bestreben, den Laut genau durch Schriftlichen wiederzugeben, nur zu Irrungen und Missverständnissen Anlass geben. Zudem war es aber auch gar nicht nötig und würde eine dem Stamme folgende Schreibung der Wörter durchaus denselben Zweck erfüllt haben. Um nicht zu weit abzuschweifen, sei es uns an einem schlagenden Beispiele gestattet, unsere Meinung zu verteidigen. Die reine und richtige Aussprache des Buchstaben r durch rasches zitterndes Anschnellen der Zungenspitze gegen den Gaumen und die obere Zahnreihe ist, wie überhaupt in Deutschland, besonders den Norddeutschen fast unmöglich, als Ersatz dient uns ein schnarchender Laut im Kehlkopfe. Je mehr dieser sich von dem richtigen Klange des r entfernt, um so mehr nähert er sich dem vokalischen Laute des a. Bei dem Mecklenburger ist er nun fast ganz zum a geworden, aber nichts berechtigt darum die Schriftsteller in dieser Mundart, das r durch a zu ersetzen, wenn dadurch, die Unverständlichkeit so bedeutend erhöht wird, wie es geschieht. Wer denkt bei „Pia" noch an den Plural von „Pierd" (Pferd), wer bei „goa" an „gor" (gar). Die Notwendigkeit zwang keineswegs zu dieser Abweichung, denn den Mecklenburger selbst befremdet die Schreibung, da er es sich nicht einfallen lässt, er spreche kein r, wenn er statt dessen a tönen lässt; er spricht das Schluss-r immer so, und würde also durchaus seinem Dialekte gemäß richtig Pia lesen, wenn auch „Pier" geschrieben steht. Wir geben es den Mecklenburger Schriftstellern zu bedenken, wie sehr sie durch ihre Eigentümlichkeit in der Rechtschreibung der Verbreitung ihm Schriften schaden, wollen aber hier auch zugleich allgemein warnen vor jeder zu genau nachahmenden Darstellung der Laute durch Schriftlichen, damit nicht eine heillose Verwirrung eintrete. Die plattdeutschen Mundarten sind enge verwandt, die ostfriesische und holsteinische z. B. gar nicht so sehr verschieden, aber ewig werden sie getrennt und einander fremd bleiben, wenn immer der eigentliche Laut jeder Landschaft durch Schriftzeichen soll wiedergegeben werden, was noch zudem überall nicht möglich ist. Wer kann sagen, was die Folge wäre, wollte der Schwabe, der Sachse, der Berliner, der Holsteiner das hochdeutsche Wort schreiben, wie er es ausspricht? Vor allem verwerflich aber und wenig volkstümlich ist es, wenn gar neue Zeichen in die Schrift hineingebracht werden, welche die hochdeutsche Schrift nicht kennt, die an Nachbarvölkern entlehnt werden und doch zu nichts nützen. Dahin gehört die Anwendung des dänischen a, eines eigentümlichen, aus a und e vereinigten Schriftzeichens, oder des e mit der französischen Cedille. Beides findet sich in der Groth'schen Orthographie, scheint uns aber durchaus unstatthaft, wenn man bedenkt, dass das Volk in Norddeutschland an und für sich schwer hochdeutsch, noch schwerer das ungewohnte Plattdeutsch liest, und nun sich mit ganz neuen und fremdartigen Schriftzeichen abplacken muss, die es schwer begreift und erlernt, die auszusprechen es sich vergebens abmüht, und nicht ahnt, dass es sich hier um einen Laut handelt, den er täglich über die Zunge bringt, der sein ganz eigentliches Eigentum ist. Wenn daher Groth in ziemlich diktatorischer Weise Professor Wiggers wegen der von ihm erfundenen und befolgten Rechtschreibung maßregelt und fragt: „Ich frage jeden plattdeutschen Schriftsteller aufs Gewissen (!), ob er wirklich die ganze Sache vorher durchdacht hat, ehe er von der Schreibung, wie Möllenhoff und ich sie wohlüberlegt nun doch einmal als die ersten, die die Arbeit tun mussten, festgestellt haben", und weiter! „Warum weicht also Wiggers von uns ab?" so antworten wir, wenigstens soweit uns als Herausgeber des „Plattdütschen Volkskalenders" diese Frage angeht, in aller Bescheidenheit: dass wir uns von der Richtigkeil der nur halb an den Stamm, nur halb an die Aussprache angelehnten, daher unzuverlässigen Schreibweise nicht haben überzeugen können, dass wir nicht Lust hatten, neue Schriftlichen einzuführen, welche in den deutschen Officinen fehlen, und zu deren Anschaffung sich die Verleger nicht immer verstehen, dass wir aber auch den plattdeutschen Lesern, auf welche zunächst doch die Schriften berechnet waren, nicht zumuten mochten, ihre alltäglichen Laute durch fremde unverständliche Zeichen vorgeführt zu sehen, und dass endlich die Bezeichnung in der Groitschen Orthographie möglicherweise für seine, die ditmarsche Mundart, ausreichen mag, die abweichenden Laute der übrigen Dialekte aber eine von jenen unabhängige Bezeichnung verlangen. Der Laut zwischen ä und ö z. B., den Groth durch das dänische ae bezeichnet, findet sich fast nur im ditmarschen Dialekt, wozu sollten wir denn das neue Schriftzeichen einführen? Für den Laut hingegen zwischen ö und den zwischen oi, ei und ee, die fast allen Plattdeutschen angehören-(grön, spr. fast groin; ick weet, spr. fast weit), bietet Groth uns keine Zeichen; kann da seine Orthographie genügen?