Die Ausstellung von Gemälden älterer Meister in München. I. Holbein und Dürer.
Aus: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik Literatur und Kunst. 28. Jahrgang. II. Semester. II. Band
Themenbereiche
Enthaltene Themen: Kunst, Malerei, Gemälde, Alte Meister, Mittelalter, Galerie, Bilderschau, Ausstellung, München, Holbein, Dürer, Handwerk,
Der löbliche Plan einer Vereinigung von Gemälden älterer Meister in München wurde in dem Maße betrieben, in welchem die Aussichten der internationalen Ausstellung moderner Bilder wuchsen. So wenig diese nun auch allen Wünschen genügen konnte, gewiss schien doch, dass sie viel Anziehungskraft ausüben und ungeachtet ihrer Gleichzeitigkeit mit der in demselben Ehrgeiz unternommenen Ausstellung in Brüssel lohnende Teilnahme beim Publikum finden werde. Wäre gleich von vornherein auch zu dem andern Zwecke der Heranziehung alter Bilder geworben worden, so hätten umfassende gemeinsame Anstrengungen wahrscheinlich eine ansehnliche Zahl interessanter und bedeutender Kunstwerke aus Vergangenheit und Gegenwart unter Einem Dache zusammengebracht. Stattdessen wurden die alten Meister gegen die modernen zurückgesetzt und das ganze Unternehmen dadurch in Frage gestellt, dass nur wenig Zeit zu den Vorbereitungen übrig blieb. In der Tat ist der erste Eindruck, den die paar Zimmer im Kunstausstellungsgebäude machen, ziemlich niederschlagend. Wenn auch der außerordentliche Wert einzelner Nummern für die geringe Zahl mehr als entschädigt, so bleibt es doch immerhin eine befremdende Wahrnehmung, von allen den Schulen, in welche man die alte Kunst einzuteilen pflegt, keine vollkommen, etliche hier überhaupt gar nicht vertreten zu finden. Der Katalog weist eine verhältnismäßig gute Anzahl altdeutscher Bilder, einige interessante flämische und holländische Stücke auf, aber so gut wie gar kein italienisches Gemälde von Rang.
Freilich darf man nicht unbillig sein. Die Schwierigkeiten eines derartigen Unternehmens sind heute größer als ehemals. Die Kritik ist in unseren Tagen scharfsichtiger und lauter als in früherer Zeit; die Bilderbesitzer müssen sich darauf gefasst machen, dass ihre Schätze ziemlich indiskret auf die Namen hin geprüft werden, die sie tragen. Ganz erklärlich daher, wenn das öffentliche Forum solcher Ausstellungen von den in der Regel empfindlichen Sammlern eher gemieden als gesucht wird. Überdies pflegen Privatsammlungen neuerdings unter strengen Bedingungen vererbt zu werden, welche Ortsveränderungen immer mehr erschweren. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hat die British Institution in London ihre jährliche historische Bilderschau einstellen müssen. Die Ausstellung in Manchester im Jahre 1853 war das erste derartige internationale Unternehmen und sie ist auch bis heute weitaus das bedeutendste geblieben; weder Dublin, noch London, noch Leeds haben solchen Erfolg gehabt.
Die gegenwärtige Münchener Ausstellung nun hätte als erste ihrer Art in Deutschland entschieden ausgiebiger sein müssen, als sie in der Tat ist; wir bescheiden uns jedoch sehr gern bei dem, was sie bietet, denn vom Standpunkte der Kunstforschung kann man sich des Nutzens nur freuen, den die allgemeine kunstgeschichtliche Kenntnis aus der Anschauung der Hauptwerke dieser Sammlung ziehen muss. Schon der Vorteil allein, dass Holbeins bewunderungswürdige Madonna auf einige Zeit aus der Dämmerung des Privatbesitzes in das volle Licht einer öffentlichen Bilderschau versetzt worden ist, kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Instruktiver freilich wäre es für das vergleichende Studium, wenn das Dresdener Gegenstück an der Seite des Darmstädter stünde; dann würden die kritischen Streitpunkte, zu welchen die beiden Gemälde Anlass gegeben haben, eher ins Reine zu bringen sein, aber es ist schon sehr viel wert, dass die kompetenten Leute Gelegenheit haben, das Darmstädter Bild eingehend zu betrachten.
Höchst wichtig ist die Ausstellung ferner für die Erweiterung unserer Kenntnis von demjenigen Entwickelungsstadium Albrecht Dürers, welches sein Aufenthalt in Venedig bezeichnet. Außerdem wird dem Deutschen Publikum unseres Wissens hier zuerst der Anblick von Arbeiten des Vlamländers Gerard David zu Teil, eines Künstlers, dessen Name noch Geheimnis war, als man seine besten Bilder schon längst klassifiziert und katalogisiert hatte. Anderen Arbeiten holländischer Schule gegenüber werden wir in die Lage versetzt, uns darüber zu entscheiden, ob Alles, was dem Van der Meer zugeschrieben wird, von Einem Manne herrühren könne, oder ob nicht dasselbe Handzeichen auf verschiedene Meister hinweist.
Bezüglich Holbeins bietet uns die Ausstellung noch über anderweite Entwickelungsstufen, als das Darmstädter Gemälde sie vertritt, lehrreichen Forschungsstoff. In dem Epitaph des Bürgermeisters Schwarz von Augsburg und der kleinen Madonna im Besitz des Herrn Pfarrer Schmitter-Hug in St. Gallen haben wir vielleicht die frühesten Beweisstücke seiner Kunsttätigkeit vor uns, während sein vollendeterer Stil aus späterer Zeit an zwei Bildnissen zu studieren ist, welche die Jahreszahlen 1533 und 1541 tragen. Dass wir mit den Bildern aus den Jahren der künstlerischen Reife Holbeins vertrauter sind als mit seinen Jugendarbeiten, liegt nicht an der größeren Zahl der ersteren, sondern daran, dass sie eine so große Anziehungskraft vor jenen voraus haben. Jedenfalls aber ist es von großem Interesse, die Entwicklung des Mannes zu verfolgen. Als er die erste Unterweisung im Handwerk der Familie erhielt, war Augsburg der Sitz einer Kunstweise, die offenbar unter dem Einfluss der rheinischen und niederländischen stand: formal-religiös in der Auffassung mit starkem Zug zum Realismus und zwar zu einem Realismus von ziemlich abstoßender Art. Mustert man das Schwarz'sche Epitaph als eine unter Mitwirkung des jungen Hans Holbein entstandene Arbeit aus der Augsburger Werkstatt, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der obere Teil des Bildes (Gottvater mit dem Schwert der Gerechtigkeit, umgeben von Christus, der die Brustwunde, und Maria, die ihre Brust entblößt) die plumpe und gemeine Weise des alten Stiles wiedergibt, wogegen die kniende Familie des Bürgermeisters weit feineren Künstlersinn bekundet, eben den eines jungen Malers, der schon auf Mannigfaltigkeit in Zügen und Ausdruck der Physiognomien ausgeht. Was diese Seite der Augsburgischen Schule ganz besonders charakterisiert, ist gutes Studium und sorgfältige Ausführung der Gewänder in milden Temperafarben; die Falten sind nicht so steif und eckig gebrochen, wie auf flämischen Bildern. Diese Eigenschaft, welche an dem Schwarz’schen Epitaph deutlich hervortritt, findet sich nun auch auf den sicherer beglaubigten Arbeiten Hans Holbeins wieder. Ein anderes Merkmal der Jugendwerke des Meisters bildet die Schwulst in der Zeichnung der Hände, eine Inkorrektheit, welche wieder die authentischere Madonna von Schmitter-Hug mit unserem Epitaph gemein hat.
Woltmann scheint das Richtige zu treffen, indem er jenes kleine Bild in St. Gallen ungefähr in das Jahr 1513 setzt. Der damals 17- oder 18jährige Holbein bewegte sich noch in dem Vorstellungskreise, der den altertümlichen Künstlern eigen war. Das Jesuskind, wie es im Kissen auf einem Simse sitzend mit dem Rosenkranz spielt, ist unverkennbar einem archaischen stabilen Typus nachgebildet; seine froschähnliche Bewegung ganz wie bei den Niederländern und Deutschen des 15. Jahrhunderts, während die dahinterstehende Mutter, die dem Knaben ein Stück Obst reicht, aber wie in Gedanken entrückt ist, schon sanftere und modernere Auffassung zeigt. Charakteristisch für den Meister sind die kräftig braunen Schatten und die schmelzende Weichheit, womit er sie in die gelben Lichter vertrieben hat. Von völlig neuem Geschmack und vortrefflich in ihrer Art ist die Marmorbekleidung des Hintergrundes mit ihrem Karnieß und dem Ornament von Genien und Medaillons. Ob Holbein berechtigt war, das Motto „Carpet aliquis cicius quam imitabitur" („Tadeln ist leichter als Nachmachen") auf den Pilaster zu schreiben, lassen wir gleichwohl so lange dahingestellt, bis erwiesen ist. dass er diesen dünkelhaften Spruch selbst dort angebracht hat. Jedenfalls sticht er sehr ungünstig von der Bescheidenheit ab, womit der große Johann van Eyck sich in all seiner Unübertrefflichkeit mit seinem schlichten „Als ikh kan" begnügte. Zu Ehren Holbeins ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir als Verfasser jenes Mottos den nämlichen unbekannten Gönner anzusehen haben, der die fernere klassische Inschrift des Bildes „IOHANES.HOLBAIN.IN.AVGVSTA.BINGEWAT.“ (sic) lieferte. Auch anderweit ist das Werk angetastet worden: Schindung und Retouche macht sich besonders in den Fleischteilen des Kinderkopfes bemerklich.
Welchen mächtigen Ausschwung der Künstler wenige Jahre nach Vollendung dieser kleinen unbedeutenden Sachen nahm, das tritt uns nun in seiner Maria vor Augen, die im Jahre 1523 für den Bürgermeister von Basel gemalt ist. Dass wir in dem hier ausgestellten Darmstädter Bilde ein Original haben, welches geraume Zeit vor dem Dresdener entstanden ist, darf jetzt wohl nicht mehr als kontrovers gelten. Die Fragen, über welche noch beträchtliche Meinungsverschiedenheiten obwalten, sind 1) ob das Bild von Darmstadt in Zeichnung, Anordnung und Typen dem Gegenstück in Dresden überlegen ist und 2) ob das Dresdener Bild eine Replik von Holbeins eigener Hand oder von einem seiner Schüler oder endlich gar eine spätere Kopie sei?
Von mehreren Seiten wird hervorgehoben, dass die Linien der Architektur sowie die Gesichter der Madonna und des Kindes, welche auf den beiden Exemplaren verschieden sind, auf dem Dresdener vorzüglicher seien als auf dem Darmstädter. Wir unsererseits sind der entgegengesetzten Meinung, und provozieren auf eine Konfrontation der Bilder, die ja in Aussicht gestellt ist, und von der wir überzeugt sind, dass sie uns Recht geben wird. Der Punkt, welcher die aufmerksamste Erwägung erheischt, ist die Technik. Je nach dem Urteil, das hierüber gewonnen wird, steht und fällt die Behauptung, wonach Holbein der Meister beider Gemälde sein soll. Aber auch hierbei wird man am besten tun, die direkte Vergleichung abzuwarten. — Ein sehr bemerkenswerter Umstand von allgemeinerem Interesse ist, dass Holbein just in der Zeit, da die Reformation mit so energischen Schritten ihren Rundlauf durch Deutschland machte, eine Komposition erfand und ausführte, die in so hohem Grade wie diese gnadenreiche Jungfrau der religiösen Glut und Devotion alten Stiles entspricht. All' seine Kunst und seine ganze Gedankentiefe hat der Meister darangesetzt, die Vorstellung milden Schutzes auf der einen, anbetender Zuversicht auf der anderen Seite zu veranschaulichen. In der Nische stehend hat Maria das Kind mit mütterlicher Zärtlichkeit an sich gedrückt; lächelnd gibt dieses der betenden Familie mit kindlich unbefangener Geste den Segen; ein Stück des von den Schultern Marias herabfallenden Mantels ist über die Gestalt des Bürgermeisters Meyer ausgebreitet, der kniend mit dem Ausdruck vollster Inbrunst zu der Schützerin emporblickt; die zum Gebet gefalteten Hände ruhen auf der Schulter des Sohnes vor ihm, dem er durch diese körperliche Berührung die Stimmung mitzuteilen scheint, die sein ganzes Wesen durchdringt; dieser Knabe wieder schlingt die Arme um das nackte Kind, das auf dem bunten Teppich steht. Kann die von manchem Kritiker zugelassene Annahme, wonach dieses letztere den jüngsten Sprössling des Meyer'schen Hauses vorstellen soll, wirklich Bestand haben? Uns dünkt, hiergegen lässt sich vielerlei einwenden, vor allem die Frage, weshalb man die nächstliegende Deutung umgeht, dass in diesem Knäbchen Niemand anders als der junge Täufer zu suchen sei? Dabei darf freilich nicht vergessen werden, dass bei dem Mangel der Heiligenscheine die Idealfiguren hier nicht so kenntlich sind wie anderwärts. — Die rechte Seite des Bildes (vom Beschauer) nimmt die schöne Frauengruppe ein: das Mädchen an vorderster Stelle im Beten begriffen, die Hausfrau der Madonna zunächst und im Schatten ihrer Gestalt. Vortrefflich dient die nahe über den Häuptern der Betenden ansetzende Konsole der Nische dazu, die Komposition zu unterstützen, deren oberer Teil durch den Halbbogen den angemessensten Rahmen erhält. Die Statur Marias sodann steht vollkommen im Verhältnis zu dem Körper des Jesusknaben, ihre vortretende linke Hüfte verhindert, dass das Kind durch die Arme hinabgleitet. — Einige Kleinigkeiten abgerechnet befindet sich die Tafel in untadelhaftem Zustande; leider aber haben Abreibung und Retouche, so mäßig sie an sich sind, gerade Stellen betroffen, wo sie die empfindlichste Entstellung verursachen. So ist Stirn und Haar der Jungfrau lädiert, die Schatten um Augen und Nase neu übergangen, Kopf und Achsel des Christuskindes in den dunklen Partien aufgefrischt, das Ohr desselben aufs äußerste verstümmelt. Auch Mund und Kinn des knienden Mädchens rechts sind nicht unberührt geblieben. Alles Andere aber ist durchaus genuin.
Wir sehen in diesem Meisterwerke die Kunst Johanns van Eyck ausgereift unter dem Einfluss der Fortschritte des 15. und 16. Jahrhunderts. Es verbindet den Realismus der alten Handwerksleistungen mit der harmonischen Einheit von Aufbau und Färbung, die den späteren Künstlern eigen wird. Dürers herbe Strenge und tiefe Kenntnis besitzt Holbein nicht, aber er entzückt uns durch die stille Weihe seiner Persönlichkeiten und ihren sanften Ausdruck, durch die Weichheit seiner Modellierung und die Fülle seiner Töne. Obgleich er bis zu einem Grade durchführt, der kaum eine Steigerung zulässt, so behält doch Alles körperhafte Masse; Licht und Schatten sind aufs wirkungsvollste verteilt, das Ganze mit sattem Auftrag und ungemeiner Sauberkeit in Guss gebracht. Die Sonne Italiens liegt auf dem Bilde, man glaubt vor dem Meisterstück eines zweiten Lionardo zu stehen. Eine kleine Sonderbarkeit ist deshalb umso auffälliger. Man kann das Bild nicht betrachten, ohne das Geschick, womit die Verkürzungen der Hände gezeichnet sind, und die liebevolle Durchbildung zu bewundern: gleichwohl sind an dem Händchen, welches das auf dem Teppich stehende nackte Kind dem hinter ihm knienden Knaben auf den Ärmelvorstoß legt, in übernatürlicher Weise 5 Finger statt 4 sichtbar. Sonst ist die Behandlung normal. Marias Mantel hat bräunliches Rot, die Tunika blau mit roter Schärpe, welche locker um die Hüften geschlungen ist; die Ärmel sind sehr schön mit Muschelgold durchwirkt und gehöht.
Über Herkunft und Geschichte des Bildes und seines Wiederspiels in Dresden hat man sich in neuester Zeit gründlich orientiert. Die Tatsachen, wie sie von His-Heusler, v. Zahn, Woltmann, Fechner beigebracht sind, hat Gottfried Kinkel in dem nachfolgendem Resumé vereinigt, das wir für jetzt auf sich beruhen lassen: Holbein war von Jacob Meyer zu Basel beauftragt, die gnadenreiche Jungfrau nebst den Porträts seiner vor ihr knienden Familie zu malen, und er genügte dieser Anforderung. Im Lauf der Jahre kam das Gemälde sodann in die Hand des Remigius Fesch, der eine Enkelin Meyers zur Frau hatte; derselbe verkaufte es an Lucas Iselin, und durch diesen gelangte es an Michael Le Blond, einen Bildermäkler in Amsterdam, den man als Kunstagenten des Herzogs von Buckingham kennt. Bis hierher weiß man nur von Einer Madonna Holbeins mit der Meyer'schen Familie. Mit dem Zeitpunkt aber, wo Le Blond das Bild veräußerte, scheinen zwei Exemplare desselben Gemäldes aufzutreten. Nach Sandrarts Angabe hat Le Blond das Baseler Original an Johann Lössert abgetreten, nach einer handschriftlichen Notiz des Remigius Fesch jedoch hätte er es der Königin-Witwe von Frankreich, Maria von Medici, verkauft. Patin will die beiden Berichte dadurch vereinigen, dass er annimmt, Le Blond habe es an Lössert und dieser es weiter an Maria von Medici gegeben. Diese Widersprüche beseitigt Kinkel mit der vielleicht ganz richtigen Annahme, dass Le Blond zwei Exemplare des Bildes besaß, wovon das eine an Lössert, das andere an die Königin kam, und welche beide als Originale passierten. Lösserts Bild ist das in der Dresdner Galerie. Es gelangte nach dem Bankerott des Besitzers in die Hände eines Avogadro nach Venedig, dort in die Familie Delfino und ist 1743 für Dresden erworben worden. — Das Darmstädter Exemplar, 1822 vom Händler Delahaute in Paris für den Prinzen Wilhelm von Preußen gekauft, gelangte durch Erbgang an seine gegenwärtigen Besitzer Prinz und Prinzessin Karl von Hessen. — Was Kinkel von Le Blonds Handlungsweise vermutet, bekommt gravierende Bestätigung durch einige historische Zeugnisse über seinen Charakter. In Mr. Sainsburys vortrefflicher Sammlung von „Papers relating to Rubens" findet sich ein Brief Balthasar Gerbiers an den Earl of Arundel, dat. Brüssel 30. Januar 1632/33, worin folgendergestalt von Le Blond die Rede ist: „Ich will Acht haben, wie ich etliche Zeichnungen finden kann, aber zu billigem Preise kann ich Nichts versprechen, denn wenn die Dinge schon in Holland teuer sind, so sind sie es hier erst recht, wo Tulpen- und Muschelliebhaber so geriebene Leute sind wie Le Blond, der die Waren mit fremdem Gelde kaufen kann, wie ich denn auch in der Tat überzeugt bin, dass er zu jenen Sachen durch das Geld meines wertesten und allezeit hochzuverehrenden seligen Lords gekommen ist; ich war ehemals Le Blonds Freund, weil ich ihn für einen ehrlichen Mann hielt; seit er sich aber so verändert hat. kann er umso weniger der meinige sein, denn er beträgt sich ja schandbar und echt amsterdammisch gegen einen so edlen Beschützer der Tugend wie Ew. Exzellenz."*)
Wir erklärten bereits, dass wir die Entscheidung der Frage, ob das Dresdener Bild Kopie oder Original sei, bis zu einer Konfrontation desselben mit dem Darmstädter vertagen möchten. Einiges Tatsächliche mag aber schon jetzt festgestellt werden: das Dresdener Exemplar ist jünger als das andere, der Gesamtton ist bleicher und es zeigt weder die Fülle des Kolorits, noch hat es überall dieselben Farben wie das Gegenbild. Das Kleid der Dresdener Madonna ist grün, die Ärmel haben keine Goldlichter, das so hoch bewunderte Antlitz zeigt ganz andere Züge und Formen, die Gestalt ist von der Brust abwärts in die Länge gezogen, und zwar dermaßen, dass das Christuskind nicht mehr an Leib und Hüfte der Mutter ruht, sondern offenbar in Gefahr ist. hinter dem Arme hinabzugleiten. Auch ist der Mantel nur ganz unmerklich über den Bürgermeister gebreitet; und dieser selbst hat seine Hände nicht auf die Schulter des Knaben gelegt. Ferner kniet die zunächst der Maria angebrachte Frauengestalt nicht im Schatten der Heiligen, sondern empfängt volles Licht auf das Profil. Die Nischenkonsolen beginnen einige Zoll oberhalb der Köpfe, und der Bogen selbst ist wesentlich in die Höhe gestreckt, sodass er keinen Halbkreis mehr bildet; der Teppich ist dagegen viel kürzer und hat weniger Farben. Die größte Abweichung aber liegt im Gesicht des Jesuskindes. Dies hat in Dresden eine so kränkliche Farbe und so melancholisches Aussehen, dass man die Entstehung der allbekannten müßigen Legende wohl begreifen kann, wonach die Madonna das eigene Kind auf den Boden niedergesetzt und dafür den kranken jüngsten Meyer auf den Arm genommen haben sollte. Hätte das Darmstädter Bild nur das eine Verdienst, dieser Deutung der Komposition ein Ende gemacht zu haben, so wäre das schon ein Gewinn für die Kunstgeschichte.—
Zwei Bildnisse, eines v. J. 1533, das andere von 1541. beide auf kaltem blauen Grunde, vervollständigen die Reihe authentischer Arbeiten Holbeins. Es sind schöne noble Leistungen der Porträtmalerei und lassen, wenn man sie mit dem dicht daneben hängenden Johann van Eyck vergleicht, in hohem Grade erkennen, welchen Fortschritt die Wiedergabe der Bewegung und der Proportion in dem Jahrhundert gemacht hatte, das zwischen den Arbeiten dieser Meister liegt, und wie Holbein bis zuletzt das technische Geschick für malerische Spezialisierung der Gewänder und Stoffe beibehielt. Von den anderen Porträts, die mit seinem Namen geschmückt sind, genügt es, die des Mörz'schen Ehepaares (Eigentum des St. Annen-Stiftes in Augsburg) hervorzuheben, welche respektable Arbeiten Ambergers sind, während drei andere (im Besitz der Herren Augusti in Stuttgart, Pestalozzi-Wieser in Zürich und Arnhard in München) nicht genau bestimmt werden können. Die von Herrn Landammann Schindler in Zürich ausgestellte Replik der Lais Corinthiaca ist eine zwar verhältnismäßig moderne, aber sehr weich und schön behandelte Kopie. —
Auch was uns die Münchner Ausstellung über Albrecht Dürer Neues lehrt, ist nicht ohne Belang. Gerade im Leben der größten Maler gibt es Partien, welche der Forschung spotten. Die Jugend Peruginos und Rafaels z. B. sind uns nur sehr ungenügend bekannt, bei Dürer ist es besonders sein Ausenthalt in Venedig, der Einfluss der dortigen Kunst auf die seinige und der seinigen auf die Venezianer, was uns immer noch zu raten aufgibt; auch sind wir nicht einmal sicher, ob Dürer nur ein Mal oder zwei Mal in Italien war. Eins der hier befindlichen Bilder, ein Salvator mundi aus dem Besitz des Herrn Reichardt in München, regt interessante Fragen über diesen Punkt an. Bevor wir aber näher auf dasselbe eingehen, wird es sich empfehlen, an einige Tatsachen zu erinnern, die mit Dürers Leben und Werken während der Zeit seiner italienischen Reise Zusammenhang haben. Aus eigenen Briefen des Meisters sowie aus anderweiten Quellen ist uns bekannt, dass er 1505 — 1506 in Venedig gewesen ist. Als alter Verehrer Mantegnas hegte er den Wunsch, diesen berühmten Meister persönlich kennen zu lernen. Ob er sich nun unmittelbar bei demselben einzuführen suchte, wissen wir nicht; aber da er mit den Fugger in Verbindung stand, für die er Aufträge hatte, war am einfachsten, sich an die Bellini zu wenden, die mit Mantegna verschwägert waren. Er suchte denn auch den Giovanni Bellini auf und wurde mit großer Auszeichnung von ihm aufgenommen, war er doch auch bereits als ein vielversprechendes Talent in seiner Kunst bekannt. Bei Bellini konnte er Empfehlungsbriefe nach Mantua erbitten und diese sind vielleicht nur deshalb nicht abgegeben worden, weil Mantua 1506 durch Quarantäne von Venedig abgesperrt war, wegen der dort grassierenden Seuche, an welcher Mantegna selbst in eben diesem Jahre starb. Dürer machte sich unterdessen in Venedig zu tun. Er war zu einer Zeit dahingekommen, da zwei wichtige Strömungen in der Kunsttätigkeit bemerkbar wurden. Seit dem Auftreten Donatellos in Padua und Venedig um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts kam das Studium der Antike, dem sich der große florentinische Kunstreformator gewidmet hatte, im ganzen Norden in Schwang. Mächtig wirkte es auf Mantegna, die beiden Bellini, die Vivarini; die älteren Arbeiten Gentiles und Giovannis so gut wie des Antonio da Murano und Bartolommeo Vivarini legen Zeugnis davon ab. Antonello da Messinas Ankunft jedoch (1473) lenkt die künstlerische Intention in eine andere Bahn; selbst Giambellin, welcher in der Öltechnik mit Antonello wetteiferte, wendet sich von der Antike ab und gibt sich ganz und gar dem Ehrgeiz hin, das Farbenelement auszubilden. Hier hat die Schule ihren Ursprung, welche den Giorgione und Tizian hervorbrachte. Giorgione bei Antonello und Bellini, Tizian nur bei Bellini lernend, und zwar eben zu der Zeit, als Dürer nach Venedig kam. Noch bestanden die beiden Richtungen neben einander, die Donateske aber im Niedergang, Antonellos Tendenz intensiv und extensiv im Wachstum. Dieser Sachverhalt lehrt verstehen wie es kam, dass Dürer brieflich gegen Pirkheimer klagen konnte, in Venedig fände man seine Arbeit nicht genug im Geist der Antike, während von ihm zugleich auch gesagt wurde, dass er kein rechter Kolorist sei. Den Einblick in das geistige Ringen des großen Nürnbergers, den solche Äußerungen geben, unterstützt nun unserer Meinung nach das vorliegende Salvator-Bild, das wir für eins aus der Reihe seiner Werke halten, welche eben diesen Zeitpunkt charakterisiert. Die Geschichte der Tafel sagt, sie sei in Dürers Atelier bis zu seinem Tode unvollendet geblieben, dann in Pirkheimers Besitz gelangt; von ihm haben sie die Imhof geerbt und von diesen bekam sie Haller von Hallerstein. Es ist ein Brustbild: Christus hat die Rechte zum Segen erhoben und in der Linken die juwelenbesetzte kristallene Weltkugel; als Folie dient dem Kopfe ein grüner Grund von giorgionesker Tonfülle. Das Haar fällt in reichen braunen Locken auf die Schultern herab, einzelne ausgeführtere Partien sind mit der minutiösen Sorgfalt behandelt, von welcher Lomazzo so bewundernd spricht; dünner Flaumbart bedeckt Lippen und Kinn. Die Hände sind schmal und langfingerig; die Zeichnung, die hier und auch am Haupte durchscheint, lässt erkennen, dass die ganze Figur zuerst mit sehr spitzer Feder in blasser Tinte angelegt und schattiert gewesen ist. Die roten und blauen Töne des Gewandes sind von venezianischer Leuchtkraft und auf der Glaskugel meisterlich reflektiert, wie auch Perlen und Amethyst am Knopfe des Reichsapfels prächtig im Wiederscheine spielen, Spezialitäten, die bei Dürer höchst merkwürdig sind. Das Ganze sieht sich an wie ein Probestück; als hätte man ihm den koloristischen Sinn abgesprochen und er sich hingesetzt, um ausschließlich venezianische Farbenwirkung herauszubringen. Und man kann nicht leugnen, er hat das erreicht, genau wie die Venezianer und mit Darangabe der strengeren Grundsätze seiner eigenen Kunst, auf Kosten des edlen Ernstes im Ausdruck, der reinen Formgebung und Proportion. Aber ist das Bild wirklich von Dürers Hand? Die Stilkritik wird bei diesem befremdlichen Sachverhalt manche Bedenken haben. Man ist versucht, an Catena oder Basaiti zu denken, aber dennoch ist es Dürers Arbeit, wir wenigstens halten es entschieden dafür. Schade nur, dass fast die ganze Übermalung abgeschunden und dadurch grade der Reiz der ausgeführteren Teile verloren gegangen ist.
Nur zwei oder drei Dürer'sche Werke aus derselben Periode lassen sich diesem hier gegenüberstellen. Das eine ist die Madonna in Strahow (Maria von Heiligen umgeben, den Kaiser Max mit Rosen krönend); auch dieses arg lädiert, aber es enthält einen zu Füßen Marias auf der Viola spielenden Engel, welcher beweist, dass Dürer, wenn es seinem Zweck entsprach, auch bellineske Züge entlehnte. Hierher gehört denn auch der gekreuzigte Christus aus der Sammlung Böhm, jetzt im Dresdener Museum, mit der Jahreszahl 1506 (nicht 1500!). wo Hintergrund und Landschaft ganz die Farbenstimmung der Venezianer und dabei die wunderbarste Detailvollendung haben. Bekundet jenes Salvator-Bild den Einfluss der Venezianer deutlich genug, so ist er auch in diesem Kruzifixus wahrnehmbar, aber uns dünkt, dass selbst die Venezianer an diesem Werke noch hätten lernen können. Denn angesichts dieses Bildes möchte sich Tizian wohl gedrungen gefühlt haben, seinen Farbenreiz noch durch einige Detailausführungen zu erhöhen. — Dr. v. Zahn hat in einer trefflichen Monographie seine Ansichten über den Einfluss der Renaissancekunst auf Dürer dargelegt. Wenn er die Frage künftig wieder aufnimmt, wird er auch den Punkt, den wir hier berühren, näher ins Auge zu fassen haben; denn erschöpft ist er noch lange nicht.
Einige andere sogenannte Dürer in der Münchener Ausstellung erregen kein besonderes Interesse. Das Studium zu einem Kopfe, mit dem Monogramm und der Jahreszahl 1511 (Besitz des Herrn Professor Mezger in Augsburg) ist völlig übermalt. Das dem Grafen Törring gehörige Porträt eines alten Mannes mit dem Datum 1520 ist moderne Replik des dem Hans von Kulmbach zugeschriebenen angeblichen Jakob Fugger im Berliner Museum oder desselben Bildes in Tempera, welches die Pinakothek in München besitzt. Der „Christus unter den Schriftgelehrten" (Sammlung des Grafen Salm) mit Monogramm, durchaus neu, wird von Einigen für ein Hoffmann'sches Machwerk angesehen.
Aus Holzschuher'schem Besitz aber sind zwei Porträts von Dürers Hand ausgestellt. Das eine (Bes. Herr Regierungsrat v. Holzschuher in Augsburg), ein alter Mann von feurig rotem Teint, in den Lichtpartien etwas retouchiert, ist mit ungemeiner Meisterschaft gezeichnet; man sieht das Geäder unter der Haut, eine Warze, die schwarz und weiß melierten Haare der Brauen und olivengraue Streifen eines groben, nicht besonders glatten Bartes. Gemalt hat Dürer das Bild lange nach der Zeit, in welcher ihm die Venezianer zu schaffen machten. — Um 1526 sodann ist das zweite dieser Porträts (Eigentum des Freiherrn von Holzschuher in Nürnberg) entstanden. Auf dem graubraunen Grund, von dem sich der Kopf abhebt, lesen wir: „VON 1526;
auf dem Schieber, der im Rahmen läuft und das Bild bedeckt, ist das Holzschuhersche Wappen mit dem Datum MDXXVI. Der alte nürnbergische Patrizier hat rote aber klare Gesichtsfarbe, Haupt- und Barthaar ist silbergrau und so fein detailliert, dass es wirklich schwebt, die Zirkelform der Augen ist die von heißblütigen, zur Apoplexie geneigten Personen. Der alte Herr trägt eine Schaube von Bisampelz über dem schwarzen Wams. Das Ganze, von dem zu jener Zeit üblichen schwarzen Rahmen umschlossen, ist ein wahres Wunderwerk von Ausführung und lohnt allein schon die Reise nach München.
Freilich darf man nicht unbillig sein. Die Schwierigkeiten eines derartigen Unternehmens sind heute größer als ehemals. Die Kritik ist in unseren Tagen scharfsichtiger und lauter als in früherer Zeit; die Bilderbesitzer müssen sich darauf gefasst machen, dass ihre Schätze ziemlich indiskret auf die Namen hin geprüft werden, die sie tragen. Ganz erklärlich daher, wenn das öffentliche Forum solcher Ausstellungen von den in der Regel empfindlichen Sammlern eher gemieden als gesucht wird. Überdies pflegen Privatsammlungen neuerdings unter strengen Bedingungen vererbt zu werden, welche Ortsveränderungen immer mehr erschweren. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hat die British Institution in London ihre jährliche historische Bilderschau einstellen müssen. Die Ausstellung in Manchester im Jahre 1853 war das erste derartige internationale Unternehmen und sie ist auch bis heute weitaus das bedeutendste geblieben; weder Dublin, noch London, noch Leeds haben solchen Erfolg gehabt.
Die gegenwärtige Münchener Ausstellung nun hätte als erste ihrer Art in Deutschland entschieden ausgiebiger sein müssen, als sie in der Tat ist; wir bescheiden uns jedoch sehr gern bei dem, was sie bietet, denn vom Standpunkte der Kunstforschung kann man sich des Nutzens nur freuen, den die allgemeine kunstgeschichtliche Kenntnis aus der Anschauung der Hauptwerke dieser Sammlung ziehen muss. Schon der Vorteil allein, dass Holbeins bewunderungswürdige Madonna auf einige Zeit aus der Dämmerung des Privatbesitzes in das volle Licht einer öffentlichen Bilderschau versetzt worden ist, kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Instruktiver freilich wäre es für das vergleichende Studium, wenn das Dresdener Gegenstück an der Seite des Darmstädter stünde; dann würden die kritischen Streitpunkte, zu welchen die beiden Gemälde Anlass gegeben haben, eher ins Reine zu bringen sein, aber es ist schon sehr viel wert, dass die kompetenten Leute Gelegenheit haben, das Darmstädter Bild eingehend zu betrachten.
Höchst wichtig ist die Ausstellung ferner für die Erweiterung unserer Kenntnis von demjenigen Entwickelungsstadium Albrecht Dürers, welches sein Aufenthalt in Venedig bezeichnet. Außerdem wird dem Deutschen Publikum unseres Wissens hier zuerst der Anblick von Arbeiten des Vlamländers Gerard David zu Teil, eines Künstlers, dessen Name noch Geheimnis war, als man seine besten Bilder schon längst klassifiziert und katalogisiert hatte. Anderen Arbeiten holländischer Schule gegenüber werden wir in die Lage versetzt, uns darüber zu entscheiden, ob Alles, was dem Van der Meer zugeschrieben wird, von Einem Manne herrühren könne, oder ob nicht dasselbe Handzeichen auf verschiedene Meister hinweist.
Bezüglich Holbeins bietet uns die Ausstellung noch über anderweite Entwickelungsstufen, als das Darmstädter Gemälde sie vertritt, lehrreichen Forschungsstoff. In dem Epitaph des Bürgermeisters Schwarz von Augsburg und der kleinen Madonna im Besitz des Herrn Pfarrer Schmitter-Hug in St. Gallen haben wir vielleicht die frühesten Beweisstücke seiner Kunsttätigkeit vor uns, während sein vollendeterer Stil aus späterer Zeit an zwei Bildnissen zu studieren ist, welche die Jahreszahlen 1533 und 1541 tragen. Dass wir mit den Bildern aus den Jahren der künstlerischen Reife Holbeins vertrauter sind als mit seinen Jugendarbeiten, liegt nicht an der größeren Zahl der ersteren, sondern daran, dass sie eine so große Anziehungskraft vor jenen voraus haben. Jedenfalls aber ist es von großem Interesse, die Entwicklung des Mannes zu verfolgen. Als er die erste Unterweisung im Handwerk der Familie erhielt, war Augsburg der Sitz einer Kunstweise, die offenbar unter dem Einfluss der rheinischen und niederländischen stand: formal-religiös in der Auffassung mit starkem Zug zum Realismus und zwar zu einem Realismus von ziemlich abstoßender Art. Mustert man das Schwarz'sche Epitaph als eine unter Mitwirkung des jungen Hans Holbein entstandene Arbeit aus der Augsburger Werkstatt, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der obere Teil des Bildes (Gottvater mit dem Schwert der Gerechtigkeit, umgeben von Christus, der die Brustwunde, und Maria, die ihre Brust entblößt) die plumpe und gemeine Weise des alten Stiles wiedergibt, wogegen die kniende Familie des Bürgermeisters weit feineren Künstlersinn bekundet, eben den eines jungen Malers, der schon auf Mannigfaltigkeit in Zügen und Ausdruck der Physiognomien ausgeht. Was diese Seite der Augsburgischen Schule ganz besonders charakterisiert, ist gutes Studium und sorgfältige Ausführung der Gewänder in milden Temperafarben; die Falten sind nicht so steif und eckig gebrochen, wie auf flämischen Bildern. Diese Eigenschaft, welche an dem Schwarz’schen Epitaph deutlich hervortritt, findet sich nun auch auf den sicherer beglaubigten Arbeiten Hans Holbeins wieder. Ein anderes Merkmal der Jugendwerke des Meisters bildet die Schwulst in der Zeichnung der Hände, eine Inkorrektheit, welche wieder die authentischere Madonna von Schmitter-Hug mit unserem Epitaph gemein hat.
Woltmann scheint das Richtige zu treffen, indem er jenes kleine Bild in St. Gallen ungefähr in das Jahr 1513 setzt. Der damals 17- oder 18jährige Holbein bewegte sich noch in dem Vorstellungskreise, der den altertümlichen Künstlern eigen war. Das Jesuskind, wie es im Kissen auf einem Simse sitzend mit dem Rosenkranz spielt, ist unverkennbar einem archaischen stabilen Typus nachgebildet; seine froschähnliche Bewegung ganz wie bei den Niederländern und Deutschen des 15. Jahrhunderts, während die dahinterstehende Mutter, die dem Knaben ein Stück Obst reicht, aber wie in Gedanken entrückt ist, schon sanftere und modernere Auffassung zeigt. Charakteristisch für den Meister sind die kräftig braunen Schatten und die schmelzende Weichheit, womit er sie in die gelben Lichter vertrieben hat. Von völlig neuem Geschmack und vortrefflich in ihrer Art ist die Marmorbekleidung des Hintergrundes mit ihrem Karnieß und dem Ornament von Genien und Medaillons. Ob Holbein berechtigt war, das Motto „Carpet aliquis cicius quam imitabitur" („Tadeln ist leichter als Nachmachen") auf den Pilaster zu schreiben, lassen wir gleichwohl so lange dahingestellt, bis erwiesen ist. dass er diesen dünkelhaften Spruch selbst dort angebracht hat. Jedenfalls sticht er sehr ungünstig von der Bescheidenheit ab, womit der große Johann van Eyck sich in all seiner Unübertrefflichkeit mit seinem schlichten „Als ikh kan" begnügte. Zu Ehren Holbeins ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir als Verfasser jenes Mottos den nämlichen unbekannten Gönner anzusehen haben, der die fernere klassische Inschrift des Bildes „IOHANES.HOLBAIN.IN.AVGVSTA.BINGEWAT.“ (sic) lieferte. Auch anderweit ist das Werk angetastet worden: Schindung und Retouche macht sich besonders in den Fleischteilen des Kinderkopfes bemerklich.
Welchen mächtigen Ausschwung der Künstler wenige Jahre nach Vollendung dieser kleinen unbedeutenden Sachen nahm, das tritt uns nun in seiner Maria vor Augen, die im Jahre 1523 für den Bürgermeister von Basel gemalt ist. Dass wir in dem hier ausgestellten Darmstädter Bilde ein Original haben, welches geraume Zeit vor dem Dresdener entstanden ist, darf jetzt wohl nicht mehr als kontrovers gelten. Die Fragen, über welche noch beträchtliche Meinungsverschiedenheiten obwalten, sind 1) ob das Bild von Darmstadt in Zeichnung, Anordnung und Typen dem Gegenstück in Dresden überlegen ist und 2) ob das Dresdener Bild eine Replik von Holbeins eigener Hand oder von einem seiner Schüler oder endlich gar eine spätere Kopie sei?
Von mehreren Seiten wird hervorgehoben, dass die Linien der Architektur sowie die Gesichter der Madonna und des Kindes, welche auf den beiden Exemplaren verschieden sind, auf dem Dresdener vorzüglicher seien als auf dem Darmstädter. Wir unsererseits sind der entgegengesetzten Meinung, und provozieren auf eine Konfrontation der Bilder, die ja in Aussicht gestellt ist, und von der wir überzeugt sind, dass sie uns Recht geben wird. Der Punkt, welcher die aufmerksamste Erwägung erheischt, ist die Technik. Je nach dem Urteil, das hierüber gewonnen wird, steht und fällt die Behauptung, wonach Holbein der Meister beider Gemälde sein soll. Aber auch hierbei wird man am besten tun, die direkte Vergleichung abzuwarten. — Ein sehr bemerkenswerter Umstand von allgemeinerem Interesse ist, dass Holbein just in der Zeit, da die Reformation mit so energischen Schritten ihren Rundlauf durch Deutschland machte, eine Komposition erfand und ausführte, die in so hohem Grade wie diese gnadenreiche Jungfrau der religiösen Glut und Devotion alten Stiles entspricht. All' seine Kunst und seine ganze Gedankentiefe hat der Meister darangesetzt, die Vorstellung milden Schutzes auf der einen, anbetender Zuversicht auf der anderen Seite zu veranschaulichen. In der Nische stehend hat Maria das Kind mit mütterlicher Zärtlichkeit an sich gedrückt; lächelnd gibt dieses der betenden Familie mit kindlich unbefangener Geste den Segen; ein Stück des von den Schultern Marias herabfallenden Mantels ist über die Gestalt des Bürgermeisters Meyer ausgebreitet, der kniend mit dem Ausdruck vollster Inbrunst zu der Schützerin emporblickt; die zum Gebet gefalteten Hände ruhen auf der Schulter des Sohnes vor ihm, dem er durch diese körperliche Berührung die Stimmung mitzuteilen scheint, die sein ganzes Wesen durchdringt; dieser Knabe wieder schlingt die Arme um das nackte Kind, das auf dem bunten Teppich steht. Kann die von manchem Kritiker zugelassene Annahme, wonach dieses letztere den jüngsten Sprössling des Meyer'schen Hauses vorstellen soll, wirklich Bestand haben? Uns dünkt, hiergegen lässt sich vielerlei einwenden, vor allem die Frage, weshalb man die nächstliegende Deutung umgeht, dass in diesem Knäbchen Niemand anders als der junge Täufer zu suchen sei? Dabei darf freilich nicht vergessen werden, dass bei dem Mangel der Heiligenscheine die Idealfiguren hier nicht so kenntlich sind wie anderwärts. — Die rechte Seite des Bildes (vom Beschauer) nimmt die schöne Frauengruppe ein: das Mädchen an vorderster Stelle im Beten begriffen, die Hausfrau der Madonna zunächst und im Schatten ihrer Gestalt. Vortrefflich dient die nahe über den Häuptern der Betenden ansetzende Konsole der Nische dazu, die Komposition zu unterstützen, deren oberer Teil durch den Halbbogen den angemessensten Rahmen erhält. Die Statur Marias sodann steht vollkommen im Verhältnis zu dem Körper des Jesusknaben, ihre vortretende linke Hüfte verhindert, dass das Kind durch die Arme hinabgleitet. — Einige Kleinigkeiten abgerechnet befindet sich die Tafel in untadelhaftem Zustande; leider aber haben Abreibung und Retouche, so mäßig sie an sich sind, gerade Stellen betroffen, wo sie die empfindlichste Entstellung verursachen. So ist Stirn und Haar der Jungfrau lädiert, die Schatten um Augen und Nase neu übergangen, Kopf und Achsel des Christuskindes in den dunklen Partien aufgefrischt, das Ohr desselben aufs äußerste verstümmelt. Auch Mund und Kinn des knienden Mädchens rechts sind nicht unberührt geblieben. Alles Andere aber ist durchaus genuin.
Wir sehen in diesem Meisterwerke die Kunst Johanns van Eyck ausgereift unter dem Einfluss der Fortschritte des 15. und 16. Jahrhunderts. Es verbindet den Realismus der alten Handwerksleistungen mit der harmonischen Einheit von Aufbau und Färbung, die den späteren Künstlern eigen wird. Dürers herbe Strenge und tiefe Kenntnis besitzt Holbein nicht, aber er entzückt uns durch die stille Weihe seiner Persönlichkeiten und ihren sanften Ausdruck, durch die Weichheit seiner Modellierung und die Fülle seiner Töne. Obgleich er bis zu einem Grade durchführt, der kaum eine Steigerung zulässt, so behält doch Alles körperhafte Masse; Licht und Schatten sind aufs wirkungsvollste verteilt, das Ganze mit sattem Auftrag und ungemeiner Sauberkeit in Guss gebracht. Die Sonne Italiens liegt auf dem Bilde, man glaubt vor dem Meisterstück eines zweiten Lionardo zu stehen. Eine kleine Sonderbarkeit ist deshalb umso auffälliger. Man kann das Bild nicht betrachten, ohne das Geschick, womit die Verkürzungen der Hände gezeichnet sind, und die liebevolle Durchbildung zu bewundern: gleichwohl sind an dem Händchen, welches das auf dem Teppich stehende nackte Kind dem hinter ihm knienden Knaben auf den Ärmelvorstoß legt, in übernatürlicher Weise 5 Finger statt 4 sichtbar. Sonst ist die Behandlung normal. Marias Mantel hat bräunliches Rot, die Tunika blau mit roter Schärpe, welche locker um die Hüften geschlungen ist; die Ärmel sind sehr schön mit Muschelgold durchwirkt und gehöht.
Über Herkunft und Geschichte des Bildes und seines Wiederspiels in Dresden hat man sich in neuester Zeit gründlich orientiert. Die Tatsachen, wie sie von His-Heusler, v. Zahn, Woltmann, Fechner beigebracht sind, hat Gottfried Kinkel in dem nachfolgendem Resumé vereinigt, das wir für jetzt auf sich beruhen lassen: Holbein war von Jacob Meyer zu Basel beauftragt, die gnadenreiche Jungfrau nebst den Porträts seiner vor ihr knienden Familie zu malen, und er genügte dieser Anforderung. Im Lauf der Jahre kam das Gemälde sodann in die Hand des Remigius Fesch, der eine Enkelin Meyers zur Frau hatte; derselbe verkaufte es an Lucas Iselin, und durch diesen gelangte es an Michael Le Blond, einen Bildermäkler in Amsterdam, den man als Kunstagenten des Herzogs von Buckingham kennt. Bis hierher weiß man nur von Einer Madonna Holbeins mit der Meyer'schen Familie. Mit dem Zeitpunkt aber, wo Le Blond das Bild veräußerte, scheinen zwei Exemplare desselben Gemäldes aufzutreten. Nach Sandrarts Angabe hat Le Blond das Baseler Original an Johann Lössert abgetreten, nach einer handschriftlichen Notiz des Remigius Fesch jedoch hätte er es der Königin-Witwe von Frankreich, Maria von Medici, verkauft. Patin will die beiden Berichte dadurch vereinigen, dass er annimmt, Le Blond habe es an Lössert und dieser es weiter an Maria von Medici gegeben. Diese Widersprüche beseitigt Kinkel mit der vielleicht ganz richtigen Annahme, dass Le Blond zwei Exemplare des Bildes besaß, wovon das eine an Lössert, das andere an die Königin kam, und welche beide als Originale passierten. Lösserts Bild ist das in der Dresdner Galerie. Es gelangte nach dem Bankerott des Besitzers in die Hände eines Avogadro nach Venedig, dort in die Familie Delfino und ist 1743 für Dresden erworben worden. — Das Darmstädter Exemplar, 1822 vom Händler Delahaute in Paris für den Prinzen Wilhelm von Preußen gekauft, gelangte durch Erbgang an seine gegenwärtigen Besitzer Prinz und Prinzessin Karl von Hessen. — Was Kinkel von Le Blonds Handlungsweise vermutet, bekommt gravierende Bestätigung durch einige historische Zeugnisse über seinen Charakter. In Mr. Sainsburys vortrefflicher Sammlung von „Papers relating to Rubens" findet sich ein Brief Balthasar Gerbiers an den Earl of Arundel, dat. Brüssel 30. Januar 1632/33, worin folgendergestalt von Le Blond die Rede ist: „Ich will Acht haben, wie ich etliche Zeichnungen finden kann, aber zu billigem Preise kann ich Nichts versprechen, denn wenn die Dinge schon in Holland teuer sind, so sind sie es hier erst recht, wo Tulpen- und Muschelliebhaber so geriebene Leute sind wie Le Blond, der die Waren mit fremdem Gelde kaufen kann, wie ich denn auch in der Tat überzeugt bin, dass er zu jenen Sachen durch das Geld meines wertesten und allezeit hochzuverehrenden seligen Lords gekommen ist; ich war ehemals Le Blonds Freund, weil ich ihn für einen ehrlichen Mann hielt; seit er sich aber so verändert hat. kann er umso weniger der meinige sein, denn er beträgt sich ja schandbar und echt amsterdammisch gegen einen so edlen Beschützer der Tugend wie Ew. Exzellenz."*)
Wir erklärten bereits, dass wir die Entscheidung der Frage, ob das Dresdener Bild Kopie oder Original sei, bis zu einer Konfrontation desselben mit dem Darmstädter vertagen möchten. Einiges Tatsächliche mag aber schon jetzt festgestellt werden: das Dresdener Exemplar ist jünger als das andere, der Gesamtton ist bleicher und es zeigt weder die Fülle des Kolorits, noch hat es überall dieselben Farben wie das Gegenbild. Das Kleid der Dresdener Madonna ist grün, die Ärmel haben keine Goldlichter, das so hoch bewunderte Antlitz zeigt ganz andere Züge und Formen, die Gestalt ist von der Brust abwärts in die Länge gezogen, und zwar dermaßen, dass das Christuskind nicht mehr an Leib und Hüfte der Mutter ruht, sondern offenbar in Gefahr ist. hinter dem Arme hinabzugleiten. Auch ist der Mantel nur ganz unmerklich über den Bürgermeister gebreitet; und dieser selbst hat seine Hände nicht auf die Schulter des Knaben gelegt. Ferner kniet die zunächst der Maria angebrachte Frauengestalt nicht im Schatten der Heiligen, sondern empfängt volles Licht auf das Profil. Die Nischenkonsolen beginnen einige Zoll oberhalb der Köpfe, und der Bogen selbst ist wesentlich in die Höhe gestreckt, sodass er keinen Halbkreis mehr bildet; der Teppich ist dagegen viel kürzer und hat weniger Farben. Die größte Abweichung aber liegt im Gesicht des Jesuskindes. Dies hat in Dresden eine so kränkliche Farbe und so melancholisches Aussehen, dass man die Entstehung der allbekannten müßigen Legende wohl begreifen kann, wonach die Madonna das eigene Kind auf den Boden niedergesetzt und dafür den kranken jüngsten Meyer auf den Arm genommen haben sollte. Hätte das Darmstädter Bild nur das eine Verdienst, dieser Deutung der Komposition ein Ende gemacht zu haben, so wäre das schon ein Gewinn für die Kunstgeschichte.—
Zwei Bildnisse, eines v. J. 1533, das andere von 1541. beide auf kaltem blauen Grunde, vervollständigen die Reihe authentischer Arbeiten Holbeins. Es sind schöne noble Leistungen der Porträtmalerei und lassen, wenn man sie mit dem dicht daneben hängenden Johann van Eyck vergleicht, in hohem Grade erkennen, welchen Fortschritt die Wiedergabe der Bewegung und der Proportion in dem Jahrhundert gemacht hatte, das zwischen den Arbeiten dieser Meister liegt, und wie Holbein bis zuletzt das technische Geschick für malerische Spezialisierung der Gewänder und Stoffe beibehielt. Von den anderen Porträts, die mit seinem Namen geschmückt sind, genügt es, die des Mörz'schen Ehepaares (Eigentum des St. Annen-Stiftes in Augsburg) hervorzuheben, welche respektable Arbeiten Ambergers sind, während drei andere (im Besitz der Herren Augusti in Stuttgart, Pestalozzi-Wieser in Zürich und Arnhard in München) nicht genau bestimmt werden können. Die von Herrn Landammann Schindler in Zürich ausgestellte Replik der Lais Corinthiaca ist eine zwar verhältnismäßig moderne, aber sehr weich und schön behandelte Kopie. —
Auch was uns die Münchner Ausstellung über Albrecht Dürer Neues lehrt, ist nicht ohne Belang. Gerade im Leben der größten Maler gibt es Partien, welche der Forschung spotten. Die Jugend Peruginos und Rafaels z. B. sind uns nur sehr ungenügend bekannt, bei Dürer ist es besonders sein Ausenthalt in Venedig, der Einfluss der dortigen Kunst auf die seinige und der seinigen auf die Venezianer, was uns immer noch zu raten aufgibt; auch sind wir nicht einmal sicher, ob Dürer nur ein Mal oder zwei Mal in Italien war. Eins der hier befindlichen Bilder, ein Salvator mundi aus dem Besitz des Herrn Reichardt in München, regt interessante Fragen über diesen Punkt an. Bevor wir aber näher auf dasselbe eingehen, wird es sich empfehlen, an einige Tatsachen zu erinnern, die mit Dürers Leben und Werken während der Zeit seiner italienischen Reise Zusammenhang haben. Aus eigenen Briefen des Meisters sowie aus anderweiten Quellen ist uns bekannt, dass er 1505 — 1506 in Venedig gewesen ist. Als alter Verehrer Mantegnas hegte er den Wunsch, diesen berühmten Meister persönlich kennen zu lernen. Ob er sich nun unmittelbar bei demselben einzuführen suchte, wissen wir nicht; aber da er mit den Fugger in Verbindung stand, für die er Aufträge hatte, war am einfachsten, sich an die Bellini zu wenden, die mit Mantegna verschwägert waren. Er suchte denn auch den Giovanni Bellini auf und wurde mit großer Auszeichnung von ihm aufgenommen, war er doch auch bereits als ein vielversprechendes Talent in seiner Kunst bekannt. Bei Bellini konnte er Empfehlungsbriefe nach Mantua erbitten und diese sind vielleicht nur deshalb nicht abgegeben worden, weil Mantua 1506 durch Quarantäne von Venedig abgesperrt war, wegen der dort grassierenden Seuche, an welcher Mantegna selbst in eben diesem Jahre starb. Dürer machte sich unterdessen in Venedig zu tun. Er war zu einer Zeit dahingekommen, da zwei wichtige Strömungen in der Kunsttätigkeit bemerkbar wurden. Seit dem Auftreten Donatellos in Padua und Venedig um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts kam das Studium der Antike, dem sich der große florentinische Kunstreformator gewidmet hatte, im ganzen Norden in Schwang. Mächtig wirkte es auf Mantegna, die beiden Bellini, die Vivarini; die älteren Arbeiten Gentiles und Giovannis so gut wie des Antonio da Murano und Bartolommeo Vivarini legen Zeugnis davon ab. Antonello da Messinas Ankunft jedoch (1473) lenkt die künstlerische Intention in eine andere Bahn; selbst Giambellin, welcher in der Öltechnik mit Antonello wetteiferte, wendet sich von der Antike ab und gibt sich ganz und gar dem Ehrgeiz hin, das Farbenelement auszubilden. Hier hat die Schule ihren Ursprung, welche den Giorgione und Tizian hervorbrachte. Giorgione bei Antonello und Bellini, Tizian nur bei Bellini lernend, und zwar eben zu der Zeit, als Dürer nach Venedig kam. Noch bestanden die beiden Richtungen neben einander, die Donateske aber im Niedergang, Antonellos Tendenz intensiv und extensiv im Wachstum. Dieser Sachverhalt lehrt verstehen wie es kam, dass Dürer brieflich gegen Pirkheimer klagen konnte, in Venedig fände man seine Arbeit nicht genug im Geist der Antike, während von ihm zugleich auch gesagt wurde, dass er kein rechter Kolorist sei. Den Einblick in das geistige Ringen des großen Nürnbergers, den solche Äußerungen geben, unterstützt nun unserer Meinung nach das vorliegende Salvator-Bild, das wir für eins aus der Reihe seiner Werke halten, welche eben diesen Zeitpunkt charakterisiert. Die Geschichte der Tafel sagt, sie sei in Dürers Atelier bis zu seinem Tode unvollendet geblieben, dann in Pirkheimers Besitz gelangt; von ihm haben sie die Imhof geerbt und von diesen bekam sie Haller von Hallerstein. Es ist ein Brustbild: Christus hat die Rechte zum Segen erhoben und in der Linken die juwelenbesetzte kristallene Weltkugel; als Folie dient dem Kopfe ein grüner Grund von giorgionesker Tonfülle. Das Haar fällt in reichen braunen Locken auf die Schultern herab, einzelne ausgeführtere Partien sind mit der minutiösen Sorgfalt behandelt, von welcher Lomazzo so bewundernd spricht; dünner Flaumbart bedeckt Lippen und Kinn. Die Hände sind schmal und langfingerig; die Zeichnung, die hier und auch am Haupte durchscheint, lässt erkennen, dass die ganze Figur zuerst mit sehr spitzer Feder in blasser Tinte angelegt und schattiert gewesen ist. Die roten und blauen Töne des Gewandes sind von venezianischer Leuchtkraft und auf der Glaskugel meisterlich reflektiert, wie auch Perlen und Amethyst am Knopfe des Reichsapfels prächtig im Wiederscheine spielen, Spezialitäten, die bei Dürer höchst merkwürdig sind. Das Ganze sieht sich an wie ein Probestück; als hätte man ihm den koloristischen Sinn abgesprochen und er sich hingesetzt, um ausschließlich venezianische Farbenwirkung herauszubringen. Und man kann nicht leugnen, er hat das erreicht, genau wie die Venezianer und mit Darangabe der strengeren Grundsätze seiner eigenen Kunst, auf Kosten des edlen Ernstes im Ausdruck, der reinen Formgebung und Proportion. Aber ist das Bild wirklich von Dürers Hand? Die Stilkritik wird bei diesem befremdlichen Sachverhalt manche Bedenken haben. Man ist versucht, an Catena oder Basaiti zu denken, aber dennoch ist es Dürers Arbeit, wir wenigstens halten es entschieden dafür. Schade nur, dass fast die ganze Übermalung abgeschunden und dadurch grade der Reiz der ausgeführteren Teile verloren gegangen ist.
Nur zwei oder drei Dürer'sche Werke aus derselben Periode lassen sich diesem hier gegenüberstellen. Das eine ist die Madonna in Strahow (Maria von Heiligen umgeben, den Kaiser Max mit Rosen krönend); auch dieses arg lädiert, aber es enthält einen zu Füßen Marias auf der Viola spielenden Engel, welcher beweist, dass Dürer, wenn es seinem Zweck entsprach, auch bellineske Züge entlehnte. Hierher gehört denn auch der gekreuzigte Christus aus der Sammlung Böhm, jetzt im Dresdener Museum, mit der Jahreszahl 1506 (nicht 1500!). wo Hintergrund und Landschaft ganz die Farbenstimmung der Venezianer und dabei die wunderbarste Detailvollendung haben. Bekundet jenes Salvator-Bild den Einfluss der Venezianer deutlich genug, so ist er auch in diesem Kruzifixus wahrnehmbar, aber uns dünkt, dass selbst die Venezianer an diesem Werke noch hätten lernen können. Denn angesichts dieses Bildes möchte sich Tizian wohl gedrungen gefühlt haben, seinen Farbenreiz noch durch einige Detailausführungen zu erhöhen. — Dr. v. Zahn hat in einer trefflichen Monographie seine Ansichten über den Einfluss der Renaissancekunst auf Dürer dargelegt. Wenn er die Frage künftig wieder aufnimmt, wird er auch den Punkt, den wir hier berühren, näher ins Auge zu fassen haben; denn erschöpft ist er noch lange nicht.
Einige andere sogenannte Dürer in der Münchener Ausstellung erregen kein besonderes Interesse. Das Studium zu einem Kopfe, mit dem Monogramm und der Jahreszahl 1511 (Besitz des Herrn Professor Mezger in Augsburg) ist völlig übermalt. Das dem Grafen Törring gehörige Porträt eines alten Mannes mit dem Datum 1520 ist moderne Replik des dem Hans von Kulmbach zugeschriebenen angeblichen Jakob Fugger im Berliner Museum oder desselben Bildes in Tempera, welches die Pinakothek in München besitzt. Der „Christus unter den Schriftgelehrten" (Sammlung des Grafen Salm) mit Monogramm, durchaus neu, wird von Einigen für ein Hoffmann'sches Machwerk angesehen.
Aus Holzschuher'schem Besitz aber sind zwei Porträts von Dürers Hand ausgestellt. Das eine (Bes. Herr Regierungsrat v. Holzschuher in Augsburg), ein alter Mann von feurig rotem Teint, in den Lichtpartien etwas retouchiert, ist mit ungemeiner Meisterschaft gezeichnet; man sieht das Geäder unter der Haut, eine Warze, die schwarz und weiß melierten Haare der Brauen und olivengraue Streifen eines groben, nicht besonders glatten Bartes. Gemalt hat Dürer das Bild lange nach der Zeit, in welcher ihm die Venezianer zu schaffen machten. — Um 1526 sodann ist das zweite dieser Porträts (Eigentum des Freiherrn von Holzschuher in Nürnberg) entstanden. Auf dem graubraunen Grund, von dem sich der Kopf abhebt, lesen wir: „VON 1526;
auf dem Schieber, der im Rahmen läuft und das Bild bedeckt, ist das Holzschuhersche Wappen mit dem Datum MDXXVI. Der alte nürnbergische Patrizier hat rote aber klare Gesichtsfarbe, Haupt- und Barthaar ist silbergrau und so fein detailliert, dass es wirklich schwebt, die Zirkelform der Augen ist die von heißblütigen, zur Apoplexie geneigten Personen. Der alte Herr trägt eine Schaube von Bisampelz über dem schwarzen Wams. Das Ganze, von dem zu jener Zeit üblichen schwarzen Rahmen umschlossen, ist ein wahres Wunderwerk von Ausführung und lohnt allein schon die Reise nach München.

000 Dürer, Landschaft

000 Madonna mit Kind, Prag

Abb. 001. Aus A. Dürers Rosenkranzfest in Prag

Abb. 005. A. Dürer, Fahnenschwinger, Stich. B. 87

Abb. 013. A. Dürer, Maria als Königin der Engel, Holzschnitt (1518).

Abb. 015. Schule Dürers, Kreuzigung Dresden.

Abb. 016. A. Dürer, Christus am Kreuz (1508). P. 24

Abb. 020. A. Dürer, Bildnis des O. Krell (1499), Alte Pinakothek, München.
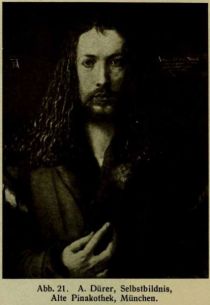
Abb. 021. A. Dürer, Selbstbildnis, Alte Pinakothek, München.

Abb. 022. Holbein, Porträt des Tuck in London (Privatbesitz).

Abb. 024. A. Dürer, Melancholie. Kupferstich. B. 74